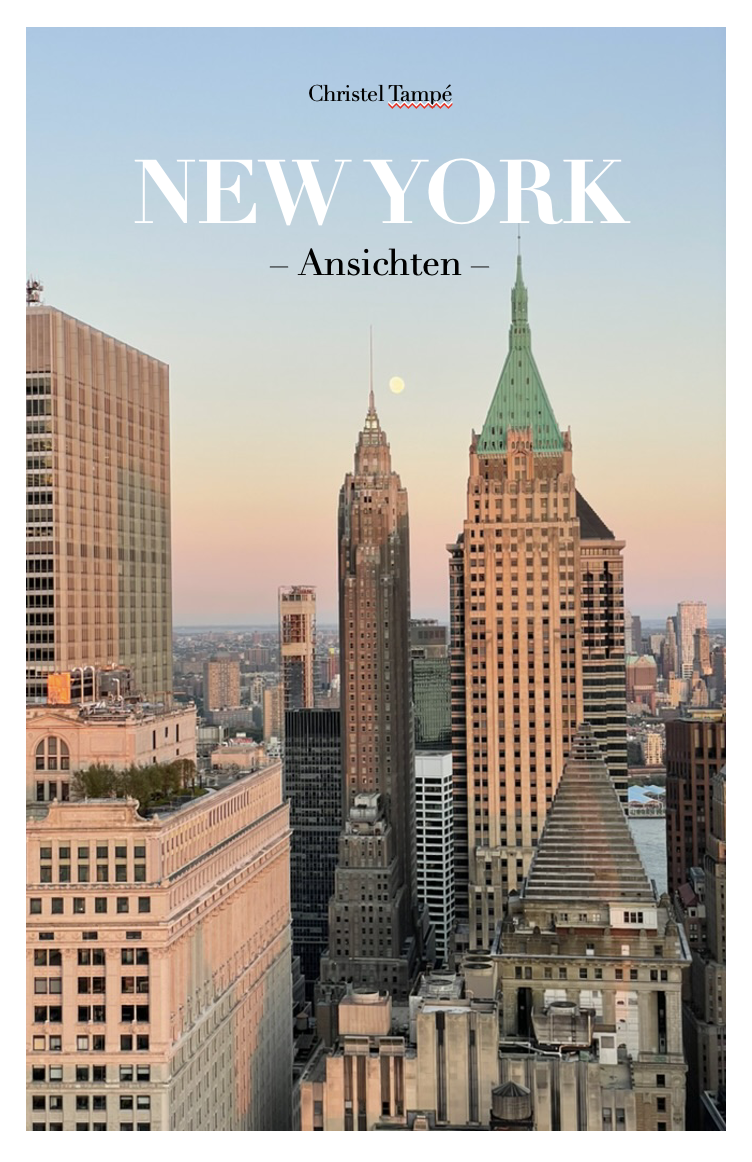Blog
Offener Brief an Kristina Schröder
Inklusion. Meine Schwester an ihrem 1. Schultag.
Gelebte Inklusion. Meine Schwester an ihrem 1. Schultag.
Sehr geehrte Frau Schröder,
Sie haben in der WELT eine Kolumne unter dem Titel „Was wir uns künftig nicht mehr leisten können“ veröffentlicht. Ich kenne als Schwester einer Frau mit Behinderung die Angehörigenseite sehr gut und möchte Ihnen hier antworten:
Jede Kette ist nur so stark, wie ihr schwächstes Glied. Dies gilt für unsere Familien im Kleinen und unser Gemeinwesen, unseren Staat, unsere Demokratie im Großen.
Unser Staat hat sich nach den dunkelsten Jahren des Dritten Reichs eine Verfassung gegeben, die in der Präambel die Verantwortung vor Gott und den Menschen betont, und das deutsche Volk als Urheber der Verfassung nennt.
Artikel 1 und 2 benennen die unveräußerlichen Grundrechte: „(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“
Diese Würde ist nicht abhängig von Wirtschaftslage, Kassenstand oder Effizienzüberlegungen. Sie gilt auch – und gerade – dann, wenn ein Mensch auf Unterstützung angewiesen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach klargestellt, dass der Staat das menschenwürdige Existenzminimum nicht relativieren darf, auch nicht aus fiskalischen Gründen.
Unsere Geschwister mit Behinderung sind keine Kostenfaktoren. Sie sind Menschen mit Rechten.
Gleichberechtigung bedeutet mehr als formale Gleichheit
Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 GG verbietet ausdrücklich die Benachteiligung wegen einer Behinderung. Doch Gleichberechtigung ist nicht erreicht, wenn Menschen mit Behinderungen theoretisch dieselben Rechte haben, diese aber praktisch nicht wahrnehmen können, weil Assistenz, Bildung oder Teilhabeunterstützung fehlen.
Wer Leistungen kürzt oder ihre Notwendigkeit grundsätzlich in Frage stellt, schafft keine „Effizienz“, sondern strukturelle Ausgrenzung. Das trifft nicht abstrakte Haushalte – es trifft konkrete Menschen.
Inklusion ist Recht – und gesellschaftliche Vernunft
Deutschland hat sich mit der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem und selbstbestimmtes Leben zu gewährleisten. Diese Verpflichtung ist geltendes Recht.
Zugleich zeigt die Bildungsforschung eindeutig:
Inklusive Bildung und Teilhabe sind keine Fehlanreize, sondern Investitionen in soziale Stabilität. Studien der UNESCO und der Bertelsmann Stiftung belegen, dass inklusive Systeme langfristig Exklusionskosten senken, gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und Bildungschancen erweitern – für alle.
Die Frage darf daher nicht lauten, ob wir uns Teilhabe leisten können.
Die ehrliche Frage ist: Was kostet es uns als Gesellschaft, wenn wir sie verweigern? Wir sehen gerade sehr nachdrücklich am Beispiel der USA, wie schnell eine Demokratie zum Schaden aller auseinanderfällt und Menschen in den Ruin getrieben werden, wenn einzelne Menschen ausgegrenzt werden, man zwar scheinheilig mit Macht für das ungeborene Leben kämpft, das geborene aber vernachlässigt, welche Härte und welcher Ton, welche Vulgarität in politische Debatten einziehen und der generellen Menschenverachtung immer mehr Raum geben.
Und noch ein Appell: Wenn wir auf Menschen mit Behinderung Rücksicht nehmen, ist dies nachhaltig für die gesamte Gesellschaft: Wir signalisieren, dass wir solidarisch sind. Dass wir Menschen wahrnehmen, denen es nicht gut geht in unserem Land. Wir überlassen Menschen mit Problemen nicht den extremen Rändern der Parteienlandschaft. Und wir schützen uns selbst, wenn uns eines Tages ein Schicksalsschlag trifft, ein Unfall, der uns in den Rollstuhl bringt, ein Schlaganfall, der uns einseitig lähmt, eine Hirnhautentzündung, eine Demenz, die Liste ist lang.
Angehörige tragen bereits die Hauptlast
Als Angehörige erleben wir täglich, wie brüchig Unterstützungsstrukturen sind. Wir fangen auf, was fehlt. Wir springen ein, wenn Assistenz ausfällt, Anträge scheitern oder Zuständigkeiten verschoben werden. Viele Familien leben permanent an der Grenze ihrer Belastbarkeit – emotional, organisatorisch, finanziell.
Wenn der Staat sich zurückzieht, bedeutet das nicht weniger Aufwand. Es bedeutet nur: mehr Unsichtbarkeit, mehr Überforderung, weniger Würde.
Geld scheint genug da zu sein: Der Schaden aus den Cum Ex-Geschäten wird mit 36 Milliarden Euro beziffert. Die Hans-Böckler-Stiftung schreibt, dass in Deutschland vermutlich um die 100 Milliarden Euro jedes Jahr hinterzogen werden, aber nur 2,4 Milliarden durch die Steuerfahndung eingetrieben wurden (und willige Steuerfahnder*innen ausgebremst).
Unser Appell
Wir fordern eine Debatte, die Rechte nicht gegen Kosten ausspielt.
Wir fordern eine Politik, die das Grundgesetz ernst nimmt – nicht nur in Sonntagsreden.
Und wir fordern, dass Menschen mit Behinderungen nicht erneut erklären müssen, warum ihre Teilhabe „gerechtfertigt“ ist.
Teilhabe ist kein Luxus.
Sie ist Verfassungsauftrag.
Und sie ist ein Maßstab dafür, wie ernst wir es mit der Menschenwürde wirklich meinen.
Mit Nachdruck und Hoffnung,
Christel Tampé
Schwester. Angehörige. Bürgerin dieses Landes.
Meine Schwester ist vor 3 Jahren verstorben. Schwester bleibt man aber sein Leben lang. Ich engagiere mich daher weiter nachdrücklich für die Interessen von Menschen mit Behinderung und deren Familien, u.a. hier: https://erwachsene-geschwister.de und hier: https://www.facebook.com/groups/ErwachseneGeschwister
Imagine
Der 8. Dezember ist für mich ein ganz besonderer Tag.
Gedenken an John Lennon
Mein Kraftort, meine Rettung in dieser Stadt ist der Central Park. Ich laufe fast jeden Tag hindurch. Ich komme vom Norden, von Harlem her, und je nach Laune, Witterung und Tagesform mäandriere ich vom Harlem Meer zum Botanischen Garten, dann hinüber zum „Loch“ mit seinen Wasserfällen, an den Wiesen und Sportfeldern vorbei Richtung Süden. Einen meiner absoluten Lieblingsplätze besuche ich immer wieder: Das Imagine Mosaik in den Strawberry Fields nahe der 72th Street, angelegt von Yoko Ono zur Erinnerung an ihren Mann John Lennon. Das Mosaik ist hübsch, es erinnert an Mosaike aus Pompeij, aber was diesen Platz ausmacht, ist etwas anderes. Es ist ein Platz lebendiger Erinnerung. Hier ist immer jemand, der oder die Musik macht, meistens ganz schlicht mit einer Gitarre und Gesang. Natürlich immer Stücke von den Beatles, und meistens ganz uneitel ohne ambitionierte eigene Interpretation, sondern zu Herzen gehend. Menschen aus aller Welt kommen hier hin und hören zu. Manche legen Blumen nieder. Alle halten in der Geschäftigkeit der Metropole kurz inne. Ja, natürlich werden auch Selfies gemacht. Selten fand ich es pietätlos, fast alle Menschen, die hierherkommen, teilen einen Moment der Ergriffenheit. An Gedenktagen, wie dem 9. Oktober, John Lennons Geburtstag, sind mehr Menschen dort, es werden noch mehr Blumen niedergelegt, dazu Zeichnungen und Fotos.
Der 8. Dezember, der Tag, an dem John Lennon spät abends direkt vor seinem Wohnhaus, dem Dakota Apartmenthaus, niedergeschossen wurde und starb, ist auch für mich ein ganz besonderer Tag, es ist nämlich der Geburtstag meiner Schwester. Sie ist ein knappes Jahr, bevor ich nach New York zog, ganz plötzlich verstorben, ich kann es immer noch nicht fassen. An ihr Grab in unserem Heimatort kann ich an ihrem ersten Todestag also nicht gehen und in dieser Stadt habe ich noch keinen Ort zum Trauern gefunden. Ich möchte an ihrem Geburtstag auch nicht in tiefer Trauer versinken, sondern vor allem an die vielen guten Momente denken, die wir zusammen verbracht haben. Ich hoffe auf jemanden, der an diesem Tag ein paar vielleicht eher melancholische Melodien der Beatles am Imagine Mosaik spielt und laufe durch die eisige Kälte dorthin. Schon von weitem höre ich die Musik. Es muss eine ganze Band dort sein, denke ich. Ich schlüpfe durch die Menschenmenge, die sich dort schon am frühen Morgen versammelt hat und staune: Umgeben von einer Menschenmenge spielen dort 15 Leute mit Gitarre, begleitet von zwei Drumsets und einem Mann mit einer Melodica. Der ältere der beiden Schlagzeuger trägt eine fantasievolle pinke Sergeant Pepper Uniform. Alle haben das dicke schwarze Beatles Songbook dabei, rufen sich den nächsten Titel zu und spielen dann gemeinsam. Es ist ein einziges spontanes Gemeinschaftserlebnis, ich bin nicht allein an diesem traurigen Tag. Alle singen, einzelne Menschen lösen sich immer wieder einmal aus dem Kreis heraus und legen Blumen, vor allem rote Rosen am Mosaik ab oder zünden dort eine Kerze an. Eine Frau stellt eine blaue Sturmleuchte dazu, die „Flame of Hope“, so steht es auf einem Zettel. Sergeant Pepper bearbeitet weiter sein Schlagzeug, Lied folgt auf Lied, die Menge singt, wippt und klatscht im Rhythmus mit. Die eisige Kälte ist längst vergessen. Banker in Anzügen, Touristen, alte Beatles-Fans – sie alle summen und singen mit. Ein junger Mann mit einem American Pittbull auf dem Schoß sitzt auf einer Bank mit geschlossenen Augen und nickt bedächtig und irgendwie zustimmend mit dem Kopf im Takt. Die blonde Frau daneben sitzt auf der Lehne der Bank, um besser sehen zu können. Ich stehe mittlerweile zwischen etlichen Gitarrenkoffern auf dem Rasen hinter den Bänken und zwei Gitarristen, die etwas später gekommen sind, ihren Notenständer aufbauen und ebenfalls das schwarze Songbuch dabeihaben. „Love me do“ erklingt, und ein Pärchen küsst sich weltvergessen. Einige der Gitarristen spielen zusätzlich noch Mundharmonika, unterstützt von dem Mann mit der Melodica. Immer wieder geht der Blick von einzelnen Menschen hoch zum Dakota-Haus, welches durch die kahlen Bäume schimmert. Trotz dieser düsteren Erinnerungen und des traurigen Datums ist es ein fröhliches Fest, das hier stattfindet.
Einer der Gitarristen packt jetzt seine Sachen zusammen in einen Bollerwagen, da ruft sein Musiker-Kollege: „Du willst doch nicht wirklich gehen?“ – „Ich muss zur Arbeit“, entgegnet er. „Aber doch nicht heute!“ rufen die anderen. Mir wird klar, dass alle hier sich einen ganzen Tag freigenommen, Urlaub genommen haben, einen Tag von den wenigen Urlaubstagen, die es in Amerika gibt, um hier dabei zu sein und Musik zu machen. Das zeigt mir, wie besonders das alles hier ist, wie groß, wie wenig selbstverständlich.
Nach etwa einer Stunde voller fröhlicher Musik erscheint plötzlich ein junger Mann mit dunkler Schirmmütze, einer randlosen Sonnenbrille mit gelben runden Gläsern, braunem Sakko und Schal – ein perfektes John Lennon Double. Die Menge teilt sich und lässt ihn in die Mitte kommen. Fotos mit ihm werden gemacht, der junge Gitarrist mit den Braids reicht ihm eine Gitarre, er ergreift sie und nun kommt noch mehr Bewegung in die Lieder. Cowbells werden geschlagen, „Baby you can drive my car“ ertönt, Beep-Beep – Beep-Beep -Yeah! Wer den Text nicht kann, liest ihn vom Smartphone ab oder singt wenigstens beim Refrain mit. Wo etwas Platz ist, wird getanzt, sonst wiegt man sich oder wippt sich die Füße warm. „Give peace a chance“ ertönt, und hier kann man wirklich glauben, dass Friede zwischen Menschen unterschiedlichster Herkunft, Hautfarbe und sozialer Stellung möglich ist, denn hier singen alle zusammen, und sie meinen es auch so, mindestens in diesem Moment. Sergeant Pepper spielt endlich „Sgt. Peppers Lonely Heart Club“, dann tönt es laut und energisch: „Twist and shout“ und die Menge tanzt und schüttelt die Hüften und Köpfe. Trotz der klirrenden Kälte wird mir jetzt ordentlich warm. Für das „Ah-Ah-Ah-Ah“ teilt der junge Mann mit den Braids mit einem Handzeichen schnell die Menge in einen vierstimmigen Chorus ein. Mittlerweile sind anderthalb Stunden vergangen. Es ist ein fröhliches Fest, das hier stattfindet. Ich fühle mich getröstet und gut aufgehoben in dieser Stimmung, mit diesen Menschen, mit denen ich singe, wippe, tanze und im Takt klatsche und wenn ich den Text nicht kenne, wenigstens summe.
Auf einmal ertönt „So this is Christmas“ – und da werde ich nun doch sentimental. Ich denke an meine Schwester, meine „dear one“, Weihnachten ist in zwei Wochen, es wird das zweite ohne sie sein. Die Kälte, die ich vergessen habe, kriecht langsam meine Beine empor. Ich vergrabe meine Hände in die Taschen meiner dicken Winterjacke, schaue ein letztes Mal auf die fröhliche Menge und verschwinde zwischen den Bäumen im Park.
Wollt ihr mehr Geschichten wie diese aus meiner Zeit in New York lesen? Dann empfehle ich euch mein Buch
New York. Ansichten ISBN 9789403837727
Ihr bekommt es im Buchhandel z.B. hier
https://www.thalia.de/suche?sq=Christel+Tampé
oder hier:
https://publishde.bookmundo.com/christeltampe
Viel Vergnügen und gute Unterhaltung beim Lesen!
Buchhandlungen
New York hat viele tolle Buchläden, die zum Stöbern einladen.
Wie toll ist das denn, wenn man sein eigenes Buch in einer Buchhandlung entdeckt? Hier bei Buchhandlung Libra e.K. Filiale Bollinger.
Keine Bange, gleich geht es weiter mit New York und seinen Buchhandlungen, aber diese Freude musste ich eben mit euch teilen, ist ja mein erstes Buch und deshalb ist alles so aufregend und neu für mich ;-)
Ich habe Architektur und Städtebau studiert und auch in Mainz, Frankfurt und München in Architektur-und Städtebaubüros gearbeitet. Aber wenn man mich privat fragt, wie ich wohnen möchte, sage ich: Wenn ich zu Fuß eine Buchhandlung erreichen kann, ist alles okay. Das ist für mich tatsächlich ein wichtiges Kriterium. Wo Buchhandlungen sind, gibt es lesende Menschen. Und wo lesende Menschen leben, ist es angenehm und es gibt dort drum herum noch viel mehr. In New York gab es etliche Buchhandlungen, die ich sehr mochte und die ich immer wieder besucht habe.:
Beim Bummeln in Greenwich entdeckte ich in der Bleecker Street einen kleinen, aber dennoch hervorragend gut kuratierten Buchladen und kaufe mir dort ein Buch über New Yorks Architektur. Sehr interessant, ich freute mich auf den nächsten Regen! Die Buchhandlung ist nicht größer als unser Wohnzimmer, dort gibt es aber eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl von interessanten Modebüchern, Fiktion und Kunstbände, Photographie und Szene-Kunst, Pop-Art, Regenbogenliteratur, eher philosophischen Betrachtungen und mehr; dazwischen irritierenderweise immer wieder Handtaschen von Marc Jacobs. Ich fragte also einen Angestellten, der mir erklärte, der Buchladen hieße Bookmarc und gehöre Marc Jacobs, dem Modeschöpfer, der dort in der Nähe wohnt. Ich bin dann übrigens mit dem Buch in einer schicken „Marc Jacobs“-Tasche (Papiertüte) aus dem Laden spaziert, mit der am Handgelenk habe ich mich dann auch in weitere, schicke, hochpreisige unsinnige Läden herein getraut, die ich sonst in meinen praktischen Anorak-und-Jeans-Touri-Klamotten eher meide (was dumm ist, denn das Verkaufspersonal ist überall wirklich ausnehmend freundlich).
Ebenfalls im West Village entdeckte ich den Traditions-Buchladen „Three Lives“. Hier wird eine gute Auswahl an Büchern von Autoren, die in New York bzw. im West Village leben bzw. gelebt haben, präsentiert. Ich kaufte einen biographischen Erzählband von Patti Smith, der sogar handsigniert ist und freue mich über meine Entdeckung. Klein und flach war es ein prima Mitbringsel.
Eine weitere interessante Buchhandlung fand ich gegenüber dem Bryant Park: Die japanische Buchhandlung Kinokuniya. Im oberen Stockwerk werden Mangas und Mangafiguren verkauft, es gibt ein winziges Café (Tomiz) mit günstigem Cappuccino, O-Nigiri, etwas Patisserie und Sandwiches. Im Erdgeschoss findet sich eine gute Auswahl an New York Büchern, Grafik, Mode und japanische Literatur in englischer Sprache, im Keller stehen japanische Bücher und alles, was man für typisch japanische Hobbies und Handarbeiten benötigt.
Housing Works Bookstore in der Crosby Street ist ein wunderschöner und etwas skurriler Laden, der sich einer sozialen Mission verschrieben hat. Mit seinen Holztreppen und umlaufenden Galerien zeigt er ein wenig vom New York früherer Jahre. Hier werden gespendete Bücher, Schallplatten (z.B. Langspielplatten von Engelbert Humperdinck, einem Schlagersänger, also, nicht dem Komponisten von „Hänsel und Gretel“, ihr seht, also eine wüste Mischung an Fundstücken) und auch Kleidung durch freiwillige Helfer verkauft, um Obdachlose und Bedürftige zu unterstützen. Es gibt ein kleines Café im Laden und während der Happy Hour kann man dort auch ein relativ günstiges Bierchen oder einen Wein trinken.
A propos “Happy hour” – direkt gegenüber einer beliebten Rooftopbar findet sich die Buchhandlung Rizzoli Bookstore am Broadway in NoMad. Hier gibt es eine große Auswahl von Kunstbüchern und interessanten New York Büchern. Der Laden gehört mittlerweile zwar zu Barnes & Nobles, ist aber wunderschön mit alten Holzregalen gestaltet und sehr einladend.
Ein nicht nur umfassendes, sondern geradezu erschlagendes Angebot von Kunstbüchern gibt es natürlich in den Museums Stores des Museum of Modern Art (dazu eine Menge an gutem Design, das überraschenderweise oft europäischen Ursprungs, nämlich aus Dänemark, Italien und Deutschland ist) und dem Metropolitan Museum of Art. Allerdings muss man sich in beiden Shops auch gut gegen Kitsch und eine Flut von Mitbringseln wappnen. Wer eine Mitgliedschaft des Museums hat bekommt dort Rabatte und es lohnt sich, Weihnachtsgeschenke dort einzukaufen.
Es ist zwar kein Buchladen, aber für Musikliebhaber auch ein Muss: Der Shop der Juillard School (auch im Lincoln Center). Hier gibt es Noten und alles Mögliche rund ums Musizieren.
Viele schöne Buchläden gibt es auch in Brooklyn. Hier ist der finanzielle Druck durch hohe Mieten nicht ganz so groß, so dass sich hier kleinere, inhabergeführte Buchläden entfalten können. Einer davon heißt „The Ripped Bodice“ und entführt einen in rosarote Mädchenträume. Hier werden ausschließlich Liebesromane verkauft und natürlich hat dieser Laden seine eigene Fangemeinde auf Instagram und TikTok.
Zurück in der Heimat denke ich oft an diese schöne Läden. Aber ich bin auch froh, dass es in meiner direkten Umgebung eine Buchhandlung gibt, die aus meinem Wohnort eine “gute Umgebung” für mich macht und wo ich seit Jahren gerne herumstöbere, Bücher entdecke und jetzt auch wieder Weihnachtsgeschenke für liebe Menschen (und auch für mich…) kaufe. Für mich ist das Lebensqualität, solche Läden in meiner Umgebung zu haben. Damit das so bleibt, möchte ich euch bitten, eure Bücher auch im regionalen Buchhandel zu kaufen, statt online. Leider hakt es immer noch an einer Stelle mit dem Vertrieb von meinem New York-Buch über den lokalen Buchhandel - über Thalia ( https://www.thalia.de/suche?sq=Christel+Tampé ) und Amazon ist es schon erhältlich. Ich arbeite mit Bookmundo an dem Problem, leider ist es noch nicht gelöst. Aber die Oberurseler unter euch können es in der Buchhandlung Libra e.K. Filiale Bollinger in der Hohemarkstraße 151 kaufen oder auch, wenn ihr auf der Suche nach Geschenken oder schicker Kleidung seid, bei Lilo Store in der Unteren Hainstraße 3.
Alle anderen finden mein Buch hier: https://publishde.bookmundo.com/christeltampe
Das Buch ist da!
Mein Buch ist da! Und nun könnt ihr es kaufen.
Die Welt des Wortes - und jetzt auch mit meinem Buch!
Nun ist es doch ein Softcover geworden. Preisfreundlich, und nicht so schwer in der Hand. Ich kann euch sagen, das war ein ganz tolles Gefühl, auf den Button „Buch veröffentlichen“ zu drücken und eine riesige Erleichterung. Jetzt beginnt für mich eine ganz neue Phase, denn das Buch soll ja auch Leser finden! Falls ihr es bestellen möchtet, geht dies am einfachsten und schnellsten direkt über diesen Link:
https://publishde.bookmundo.com/site/userwebsite/index/id/christeltampe/bookdetails/22012505
oder tatsächlich auch über eure Buchhandlung um die Ecke (da dauert es noch ein paar Tage, bis Bookmundo die ISBN und alles weitergibt), das kann dann allerdings ein paar Tage länger dauern, weil die es ja auch von Bookmundo beziehen, aber ihr unterstützt damit ein lokales Geschäft und diesen Gedanken mag ich sehr. Für alle Fälle ist hier die ISBN: 9789403837727
Dieses Buch ist unbedingt etwas für diejenigen von euch, die meinen Blog mögen. Hier bekommt ihr noch mehr, und das mit vielen (noch mehr!) atmosphärischen Fotos, welche die Texte ergänzen und illustrieren. 245 Seiten zum Schmökern und visuellen Eintauchen in die Stadt, die für viele ein Sehnsuchtsort ist oder war. Wer erfahren möchte, wie es sich in New York lebt, ist hier richtig. Das Buch ist auch etwas für Leser*innen, die sich dafür interessieren, wie diese Stadt eigentlich funktioniert. Für Menschen, die sich fragen, ob sie jemals in eine so laute, lärmende, grelle Stadt reisen sollen. Meine beiden Testleserinnen waren jedenfalls anfangs unterschiedlich skeptisch, eine versucht seit Jahren, mich zu einer Fotoausstellung zu überreden, kannte aber kaum Texte von mir, die andere möchte niemals nach New York reisen. Beide haben das Buch verschlungen und konnten nicht mehr aufhören zu lesen. Es scheint also zu funktionieren und ich hoffe daher, dass mein Buch „New York Ansichten“ euch ebenfalls gefällt. Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt es gerne weiter!
Hurra, ein Buch!
Ich habe ein Buch (mit vielen Fotos) über meine Zeit in New York geschrieben. Das war ein langer Weg, den ich euch hier kurz vorstelle.
Mockup von meinem Buch. So soll das Hardcover aussehen.
Die Texte waren schon fast alle im Frühjahr und Sommer geschrieben, Blog sei Dank! Mit Hilfe meiner Tochter als Schreib-Buddy ging es auch bei den fehlenden Texten zügig voran. Aber dann konnte ich irgendwann dem einen Thema nicht mehr ausweichen: Die Fotoauswahl. Erstens dauert es länger, und zweitens, als man denkt – es war überwältigend und schwer. Tausende von Bildern musste ich durchsuchen. Das war teils einfach, weil es ein paar Lieblingsbilder gab, andererseits aber auch schwierig, denn um ein ganzes Buch zu bebildern, mussten die Fotos auch untereinander stimmig sein, eine ähnliche Bildsprache haben. Der nächste Schritt war, das Buch zu planen. Lose Texte sind etwas anderes als ein zusammenhängendes Buch. Nur chronologisch geordnet würde es nicht funktionieren, das war schnell klar. Es brauchte einen „Opener“, eine gewisse Dramaturgie (nicht viel, es ist ja ein Sachbuch), eine gewisse Ordnung. Und dann ein Layout.
Es war für mich schnell klar, dass ich das Buch im Selfpublishing herausgeben würde, einfach, damit es zügig in die Welt kommt. Ich schaute mich also um, und entschied mich für einen Anbieter, bei dem ich schon seit Jahren viele gute Erfahrungen mit Fotobüchern gemacht habe. Blurb hat einfach ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Es stellte sich allerdings bald heraus, dass die Software, mit der ich sonst immer rasch vorangekommen bin, für ein Buch mit viel Text absolut nicht geeignet war, jedenfalls, wenn ich sie bedienen sollte. Meine alte Adobe-Software, noch mit Lizenz dauerhaft erworben, hatte über die letzten Jahre immer mehr geruckelt, und mit jedem Update der restlichen Software auf dem Rechner war sie immer anfälliger geworden, bis sie kaum noch zu gebrauchen war. Als ich dann einen neuen Laptop nutzte, war das auch der Schritt weg von Adobe. Das Abo ist schlicht nicht wirtschaftlich, wenn man es nicht andauernd professionell nutzt. Also blieb Pages für die Erstellung der Datei. Kinners, ich sach‘s euch, das war ein ordentliches Gefrettel! Was habe ich geflucht. Es gingen Stunden, Vormittag und Nachmittage ins Land, meine Augen schmerzten, der Rücken wurde krumm, ich musste regelmäßig Yoga einbauen, um Schlimmstes an meiner Wirbelsäule zu verhindern. Irgendwann aber war es soweit: Hurra, ich konnte ein brauchbares PDF exportieren.
Also Upload bei Blurb. Die nächste Hürde: Covergestaltung. Bei Blurb habe ich Übung damit, das ging schnell und gut. Etwa anderthalb Wochen später klingelt der Paket-Bote und ich halte das Buch in meinen Händen. Ich sage euch, das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl! Aber: Das Coverfoto war an einer Stelle verpixelt, und beim Aufschlagen des Inhaltsverzeichnisses sehe ich sofort die ersten Fehler. Ich kann einfach nicht am Bildschirm korrigieren. Mein Mann hat dann die erste Korrektur gelesen, er ist auch ein hervorragender Detektor von überzähligen Leerzeichen. Eine Freundin hat die zweite Korrektur gelesen. Erstaunlicherweise hielten sich die Rechtschreibfehler wohl ziemlich in Grenzen, aber dass ich ein Foto doppelt drinnen hatte (ein Fehler, der mir eigenartigerweise immer wieder passiert), habe ich selbst gemerkt. Und es gab Formatierungsfehler, ab einem der hinteren Kapitel war die Schriftgröße unbemerkt einen Punkt größer. Das alles musste also korrigiert werden. Das mit der Schriftgröße war besonders bitter, denn nun waren die Seiten leerer, es brauchte zusätzliche Fotos und wieder begann die Jagd nach Schusterjungen und Hurenkindern, die es in der Typographie unbedingt zu vermeiden gilt…
Leider fallen nach ein paar Blicken ins Buch schon zwei Seiten heraus. Und dann gibt es etwas, was mich irritiert: Die Versandkosten waren fast so teuer wie das Buch, das ist ziemlich unwirtschaftlich für die zukünftigen Leser*innen. Ich versuche also herauszufinden, woran das liegt und muss feststellen, dass Blurb zwar seine Fotobücher in der EU druckt, die Taschenbücher aber in den USA. Da zugleich die Nachrichten voll sind von immer neuen Zöllen, schließlich auch auf Postsendungen unter 800 g, wird das mir zu heikel. Es muss ein neuer Anbieter her. Ich weiß, was ich will: Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, etwa die Hälfte Farbseiten und vor allem eine ISBN und die Möglichkeit, über den Buchhandel bestellen zu können. Eine Freundin schlägt mir Tredition vor, sie hatte dort sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich finde es überzeugend, aber mein Buch mit seinen vielen Farbseiten würde dort zu viel kosten. Also schaue ich mich weiter um und finde schließlich Bookmondo, einen Anbieter aus den Niederlanden. Die Webseite auf Deutsch weist eine Menge Rechtschreibfehler auf, für einen Buchverlag nicht gerade vertrauenerweckend. Die Bewertungen sind entweder euphorisch gut oder grottenschlecht. Der Preis, der beim Buchpreisrechner für mein Buch errechnet wurde, ist hingegen sensationell. Aber ich stelle fest, es gibt eine neue Schwierigkeit: Alle Seiten des mit Pages erstellten Buchs zählen als Farbseiten, auch die mit Text, denn Apple druckt Schrift grundsätzlich nicht mit der Farbeinstellung „schwarz“, sondern „tiefschwarz“, da kommen auch Farbanteile dazu, dafür ist dann der Druck besser. Ich rechne das also noch einmal durch und überlege, wieviel Arbeit es mich kosten würde, das PDF anders zu formatieren. Schließlich entscheide ich mich für die Farbvariante, der Aufwand, den ich leisten müsste, rechnet sich nicht. Nun habe ich nichts mehr zu verlieren, ich beginne, ein neues PDF zu erstellen (die Maße sind ganz leicht unterschiedlich zu Blurb) und schließlich hochzuladen und (ohne ISBN) zu bestellen. Der erste Versuch ruckelt. Bis ich endlich soweit bin, ist es Abend geworden, eine Phase, in der bei uns das Internet regelmäßig schwächelt. Der Laptop glüht, ich gehe ins Bett. Es ward Abend und es ward Morgen, der zweite Tag. Mit einem Kaffee in der Hand schaue ich, ob sich etwas über Nacht getan hat, und siehe, der Upload ist komplett. Jetzt fehlt also noch das Cover. Für alle, die so etwas noch nie gemacht haben: Es gibt eine Vorderseite, eine Rückseite, und natürlich den Buchrücken. Dieser muss so breit sein, dass alle Seiten hineinpassen, das heißt, man kann ihn erst anpassen, wenn man die Seitenzahl komplett hat. Bei Bookmondo gibt es einen Cover-Generator, der kommt aber für mich spontan nicht in Frage, weil ich in der Umschlaggestaltung sehr eingeschränkt gewesen wäre, vor allem auch in der Schriftwahl. Das Adobe-Template kann ich nicht herunterladen, weil ich ja nicht mehr mit Adobe arbeite. Notgedrungen entscheide ich mich also für die Version Covergenerator und das umwandeln in ein PNG (JPG hätte auch funktioniert, aber dann wird die Schrift unter Umständen nicht scharf). Worauf ich leider keinen Einfluss habe, ist die Platzierung des ISBN-Strichcodes, wenn ich im nächsten Schritt eine ISBN-Nummer beantrage. Das musste ich also in Kauf nehmen für einen guten Preis für meine hoffentlich zahlreichen Leser*innen.
Das Probeexemplar kommt nach 4 Tagen. Es sieht gut aus. Die leichte Welle im druckfrischen Buch liegt nach ein paar Tagen gerade. Das Softcover ist etwas dünner und nicht ganz so hochwertig wie bei Blurb, aber durchaus okay. Das Titelfoto hat keine verpixelten Stellen. Die Schrift am Buchrücken muss ich noch etwas kleiner machen, sie steht ganz leicht über. Die Qualität der Fotos innen ist besser als bei Blurb, das begeistert mich. Die Schrift sieht gut und klar aus. Wahrscheinlich liegt das am „Tiefschwarz“, denke ich und bin zufrieden. Ich schlage das Buch in der Mitte auf und mein Blick fällt sofort auf einen Rechtschreibfehler… autsch. In den folgenden Tagen finde ich allerdings keine weiteren Fehler. Der Hersteller hat eine Seite zusätzlich eingepflegt mit Hinweisen zur Produktsicherheit. Die gefällt mir an der Stelle nicht, weil dann zwei verschiedene Schrifttypen nebeneinander zu sehen sind, die nicht zueinander passen. Eine Leerseite wird dieses Problem lösen.
Ich bin neugierig, wie sich das Buch als Hardcover machen würde und mache einen weiteren Upload mit den eingepflegten Korrekturen und einem neuen Cover (der Buchrücken wird breiter sein, und die Maße sind dementsprechend anders). Insgesamt wird das für mich unwirtschaftlicher sein, aber das ganze Projekt ist ja nicht wirtschaftlich. Und wenn es schon nicht ökonomisch ist, dann soll es wenigstens so schön wie möglich sein, finde ich. Für euch.
Ein Blick zurück auf 2024
2024 - ein Rückblick. Die Weichen sind schon gestellt für 2025.
Hier werden die Weichen gestellt…
2024 ist ein Jahr mit vielen verschiedenen Facetten. Einige bleiben schattig und dunkel, andere funkeln im Sonnenlicht. New York funkelte die meiste Zeit, blendete immer wieder, und doch hatte ich hier den wohl größten Schreckmoment des Jahres. Aber fangen wir doch von vorne an: Nach der Weihnachtspause zu Hause ging es wieder zurück nach New York. Auf den Bürgersteigen lagen die ausgemusterten, vertrockneten, struppigen Weihnachtsbäume. Die Luft war eisig kalt. Selbst die Tauben hockten völlig verfroren aufgeplustert neben den U-Bahn Ausgängen auf dem Boden. Wer auf den Bus warten musste, stellte sich über die warmen Abluft-Schächte. Aktivitäten wurden nach drinnen verlegt. Ab ins Museum: Museum of Natural History, Guggenheim, MoMA. Dann aber auch Madame Butterfly in der MET, ein Konzert auf der Upper West Side – auf dem Weg zurück die Begegnung mit Gemüseladen-Ratte (https://www.ansichten.me/blog/goa51eeqapnuj8o6u8xoju37i8j8w7 ). Frostige Spaziergänge im Central Park. Am 16. Januar endlich der erste Schnee, das Harlem Meer zugefroren, die Enten stehen auf dem Eis, lange Schatten und Sonnenuntergang. Bei einem Ausflug nach Brooklyn zur dortigen Dependance PS1 des MoMA sind die Wasserleitungen eines Hydranten geplatzt, eine eisige Skulptur. Schneidend kalter Wind in den Straßen. Besuch von Freunden und weitere Schneespaziergänge. Erste Schneeglöckchen lassen uns auf wärmere Tage hoffen. Es bleibt: Kalt. https://www.ansichten.me/blog/januar Ein Konzert mit den New Yorker Philharmonikern in der Geffen Hall beschließt den Januar.
Auch im Februar bleibt es kalt. Auch im Februar gibt es Besuch aus der Heimat. Die Apple Vision Pro macht New York verrückt. Erste Influencer hocken wichtig damit in Parks oder der Subway und lassen sich dabei filmen. Ich nutze die klare, harte Wintermittagssonne, um Schattenfotos unter der U-Bahn-Brücke an der 125th Straße zu machen. Abends geht es mit dem Besuch in die Geffen Hall, Cameron Carpenter gibt ein furioses Orgelkonzert. Ein paar Tage später besuchen wir wieder Bill’s Place bei uns in Harlem um die Ecke, und hören Jazz. Musik und Museen, auch im Februar. Und ein neuer Coffee-Place in Williamsburg fürs Wochenende. Chinesische Neujahrsfeiern mit viel Papierkonfetti, eine akademische Feier mit Mehr-Gänge-Menu in der Columbia-Universität, von der ich einen unglaublich schönen und großen Blumenstrauß mitsamt der Vase mitnehmen darf. Dafür gönnen wir uns ein Taxi durch den verregneten Abend nach Hause. Am nächsten Morgen wieder Schnee, fluffige drei oder vier Zentimeter, also ab in die Stadt zum Fotografieren, traumhafte Fotos entstehen in knapp anderthalb Stunden, dann sind die Finger steifgefroren, die Schuhe und Füße patschnass und eiskalt und der Schnee von den Straßen und Wegen und Bürgersteigen geräumt. Der Valentinstag in New York ist ein besonderes Fest: https://www.ansichten.me/blog/der-preis-der-liebe . Verschneit und mit Besuch geht es weiter, und ein Wochenendbesuch führt uns zu Freunden nach New Haven.
Der März beginnt mit Alarm: https://www.ansichten.me/blog/alarm Es brennt nachts in unserem Block. Ein Ausflug nach Staten Island bei schönstem Sonnenschein ist wie ein Urlaub in Maine: Obwohl die Halbinsel verwaltungstechnisch zur Bronx gehört, reihen sich hier feine kleine Holzhäuser mit großen Gärten aneinander, an der Hauptstraße findet man zahlreiche Restaurants mit Seafood. Die ersten Krokusse blühen, und die Neonreklame lädt zum Lobster-essen ein. Die Temperaturen werden etwas milder, aber das nächste Wochenende strömt wieder der Regen, so flüchten wir uns patschnass schon am frühen Morgen in die Kings County Destillerie am Navy Yard in Brooklyn, ein toller Platz für Stillleben: https://www.instagram.com/airwingsandroots/ Inzwischen habe ich eine Liste gemacht, was ich noch alles in New York anschauen muss, bevor wir wieder nach Hause gehen. Spoiler: Natürlich schaffen wir das alles gar nicht. Das Wetter ist regnerisch und unfreundlich, besonders an den Wochenenden. Aber ab und zu wird es frühlingshaft: Erste Kirschblüten verzaubern die Allee neben dem großen Wasserreservoir und im See unter der Bow Bridge im Central Park sonnen sich die Wasserschildkröten auf einem warmen Felsen, der Winterschlaf ist vorbei. Ich besuche eine fancy Modenschau von Diane von Fürstenberg in „The Shed“. Ein Meer von Frühlingsblüten empfängt mich dort. Das nächste Wochenende scheint die Sonne strahlend vom blauen Himmel und wir nutzen die Gelegenheit, um endlich Ellis Island zu besichtigen. Für mich ein bewegendes Erlebnis. Ich suche natürlich nach einem Verwandten väterlicherseits und einer Urgroß-Schwipp-Cousine oder so ähnlich mütterlicherseits, vergeblich. Aber ich erkenne in den Vitrinen und Schautafeln, dass die Probleme von Flucht, Migration und Integration auch vor 100 Jahren genau die gleichen waren. Nur damals sind jeden Tag viel mehr Leute nach Ellis Island gekommen, als heute in einem Monat. Mascha Kaleko schreibt: „Wir sind ohne Geld. Ohne Freunde. Ohne Verbindungen. Ohne Hoffnung. Fahrgeld fehlt. Schuhe fehlen. [...] Verfluchtes Geld. [...] Ein Bankkonto ist eine gute Vorbeugung gegen Depression. [...] Noch nie waren wir so „refugees“ wie jetzt. [...] Organisierte Wohlfahrt macht die Menschen verantwortungslos dem leidenden Einzelwesen gegenüber. Sie haben ihren Beitrag bezahlt. Ihr Gewissen ist rein. Du verrecke. Warum bist du nicht successful? Wobei success – nur Geld heißt.“ Ich nehme mir vor, einen Artikel für meinen Blog zu schreiben. Noch habe ich es nicht geschafft. Dann kommt er halt in das Buch, mehr dazu später. Wir entdecken Queens mit dem wunderbaren Noguchi Museum, Astoria mit seinen kulinarischen Genüssen und schaffen es endlich an einem weiteren restlos verregneten Nachmittag, das Louis Armstrong Museum und sein Wohnhaus zu besichtigen. Auch das muss ich noch mit einem eigenen Artikel verbloggen, What a wonderful world“. Die „Harlem Renaissance“ Ausstellung im Metropolitan Museum of Arts ist ein weiterer Höhepunkt. Ich besorge Mitbringsel, die Zeit hier neigt sich unaufhörlich dem Ende entgegen. Der letzte Besuch steht vor unserer Türe und wird herzlich hineingebeten. Das letzte Mal gehen wir zu Bill’s Place. Das letzte Mal zu unserem Lieblingscafé in Williamsburg. Noch ein letzter Besuch bei einem Kollegen meines Mannes. Ostern. April! Ein letztes Mal im Guggenheim, ein Abschied vom Dendur-Tempel, noch ein letzter Cocktail auf unserem Lieblings Rooftop. Die Zeit jagt. Die Stunden zerfließen. Der Boden bewegt sich, die Wände wackeln – die Erde bebt am letzten Tag. Einen Tag später steigen wir in das Flugzeug, das Kapitel New York ist Geschichte.
Zu Hause blüht der Bärlauch in den Auenwäldern rund um die Nidda. Der Grill wird angeworfen. Ein herzzerreißend trauriger Anlass führt uns zu Freunden nach Arnstadt in Thüringen. Statt in die MET geht es wieder in die Frankfurter Oper, die ist preisgekrönt als bestes Opernhaus. Und das Bockenheimer Depot ruft.
Schwupp, schon radeln die Radfahrer vom Rennen am 1. Mai vorbei. Ein Jahrgangstreffen der Schule: „Mensch, du hast dich ja gar nicht verändert!“ – ist das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung? Aber schön ist es auf alle Fälle, alle anderen wieder zu sehen. Eine bewegende Inszenierung des „Tannhäuser“ in der Frankfurter Oper rührt zu Tränen. Muttertag in Stuttgart, im 7. Stock ohne Aufzug. Auch schön. Mit Blumen und Rind vom Auftragsgriller.
Im Juni geht es in die Toskana, zunächst in eine wundervolle Kartause bei Siena, einfach traumhaft. Mit einem kleinen Fiat Cinquecento sause ich über die Hügel und sehe San Gimignano, Volterra und schließlich Florenz. Am schönsten ist der Blick morgens und abends vom Fenster der Kartause über den darunterliegenden Barockgarten hinüber zu den Olivenbäumen. Am anstrengendsten ist es, in der gleißenden Sonne den steilen Berg zu unserem Hotel in Florenz hinaufzusteigen. Zu Hause wird langsam klar, dass mir der Blog über New York nicht reicht. Angeregt von meiner Freundin Angelika ( https://www.freiraumfrau.de ), die ihre „Geschichten aus dem Freiraumbus“ ( https://www.freiraumfrau.de/buch/ ) niedergeschrieben und selbst herausgegeben hat, fasse ich den Entschluss, ein Buch zu schreiben.
Im Juli spielt mein Orchester, die www.kingstruments.de ein Sommerkonzert in Königstein und ich bin tatsächlich wieder dabei, das fühlt sich gut an. Der Sommer, auch der August, besteht aus Kurzausflügen nach Straßburg, Iphofen und München, Abenden auf der eigenen Terrasse, etwas, das ich New York sehr vermisst habe, Schwimmen und Schreiben und Foto-Sortieren.
Im September ist es soweit: Ein Abschiedsbesuch in New York. Doch noch einmal die Sehnsucht stillen, die Chance, endlich bei gutem Wetter doch noch Governors Island sehen. 11. September. Stilles Gedenken, aber der böse orange Mann fährt an uns vorbei, mit viel Security vorneweg und hinterher. Dazu kommen etliche Rooftops, auf die „Normal-Sterbliche“ nicht kommen: Ein Abend auf der Dachterrasse des New York Athletic Club direkt am Central Park, und bei einem Freund, beide Male mit Sonnenuntergang – atemberaubend schön, und wahrlich beeindruckend. Wir genießen einen Spaziergang durch unser altes Viertel in Harlem und besuchen unsere Lieblingscafés. Und ich fotografiere alle Motive, die mir für mein Buch noch fehlen. Ich freue mich, dass der Elisabeth Street Garden immer noch existiert, obwohl dort ein Apartmenthaus entstehen soll. Viel zu schnell ist auch diese Woche vorbei.
Der Oktober beginnt mit der Probenfreizeit meines Orchesters in der Landesmusikakademie Schlitz. Das sind gute und intensive Tage, die uns nicht nur als Orchester voranbringen, sondern auch als Gemeinschaft. Bei bestem Herbstwetter zeigen wir Freunden aus New York den Rheingau, so etwas gibt es in New York nicht. Sie freuen sich darüber, mitten im Weinberg zu stehen und in aller Öffentlichkeit Wein trinken zu dürfen. Statt Hochhäuser fotografiere ich jetzt im Wald hinter unserem Haus Pilze und im November auf dem Feldberg Greifvögel in einem Workshop, den Nicole Herr (https://www.instagram.com/nicoles_moments/) mit dem Falkenhof Feldberg ( https://www.falknerei-feldberg.de ) organisiert hat. Wir lernen viel über die Vögel, aber es sind vor allem die Momente im Wald mit diesen wunderschönen Tieren, die noch lange in mir nachhallen. Eine kurze Reise führt mich noch einmal in den Süden, nach Barcelona. Am Geburtstag meines Vaters, eines Architekten, besuche ich den Pavillon von Mies van der Rohe und denke an meinen verstorbenen Vater, der mir so viel über Architektur beigebracht hat.
Und – schwupp! – ist das Jahr auch schon zu Ende. Dezember. Schnell noch ein langes Wochenende nach Kopenhagen und Lund zum furiosen Weihnachstkonzert meiner Tochter. Und dann ist es soweit, Sohn und Tochter machen sich auf den Weg an die Stätte iher Geburt, um die IT-Probleme ihrer Eltern zu lösen, oder so ähnlich. Mir gab Judith Peters (https://judithpeters.de) den Anlass, diesen „Jahresrückblog“ zu schreiben. Das habe ich gerne gemacht und freue mich auch darauf, den Blog von anderen zu lesen.
Ich bin sehr dankbar für dieses volle Jahr. Der Aufenthalt in New York hat mich wieder zu meinen kreativen Wurzeln zurückgebracht. Ich weiß nun, dass mich meine Füße weit tragen können (insgesamt bin ich in New York ungefähr 2000 km gelaufen). Ich habe aber auch gelernt, dass ich kein Stadtmensch bin. Trotzdem vermisse ich regelmäßig am Wochenende die vielen Möglichkeiten, die diese Stadt bietet. Ich habe entdeckt, dass ich Schreiben mag und habe über das regelmäßige Schreiben auch eine Schreibstimme gefunden. Schön, dass ich da gute Unterstützung vom https://www.schreibzirkel-frankfurt.de hatte. Da freue ich mich schon auf mehr. Und herzlichen Dank an meine Tochter für viele Schreib-Dates!
Ich freue mich auf 2025. Trotz aller Sorgen um die politische Lage in der Welt. Wie jedes Silvester blicke ich mit dieser Unsicherheit auf das Jahr, aber es ist auch so viel Vorfreude dabei, auf alles, was ich erleben, fotografieren und schreiben möchte. Und hoffentlich ist auch wieder viel Musik dabei. Mein großes Ziel: Natürlich endlich das New York Buch veröffentlichen. Und es gibt schon ein kleines Nebenziel, ein weiteres Buch-Projekt, welches ich anfangen werde. Ich bin offen für 2025, mein Motto ist: “Du sollst dir (k)ein Bildnis machen“.
Nacht
Nachts in Manhattan
Nachts in Manhattan
Die Sonne geht unter, das wird von allen Aussichtsplattformen und Rooftop-Bars gefeiert und mit dem Handy dokumentiert. Die Stadt fängt an zu glitzern, in den Bürotürmen leuchten die Fenster in allen vom kalten Neon bis zum warmen Weiß. Dem deutschen Architekten des Seagram-Buildings, Ludwig Mies van der Rohe, war das einheitliche Leuchten seines Gebäudes so wichtig, dass er die genaue Art der Leuchtmittel vorschrieb. Von meinen ersten New York Besuchen (da standen die Twin Towers noch) hatte ich das Glitzern ein wenig anders in Erinnerung: Der Times Square war zwar schon damals verrückt genug, aber tendenziell noch etwas „harmloser“, dafür strahlten alle Büros hell erleuchtet alle Nächte hindurch. Im Zuge des Energiesparens hat sich das etwas verändert, nicht mehr alle Räume bleiben die ganze Nacht hindurch hell beleuchtet und tragen so zum allgemeinen Glitzern der Stadt bei. Andererseits waren viele hohe Gebäude, die heute dazu beitragen, noch gar nicht errichtet.
Mit dem Zoom-Objektiv meiner Kamera habe ich an einem Abend in die Büros geschaut: Die allermeisten dieser Räume liegen einsam und verlassen dort. Selten dreht eine einsame Reinigungskraft ihre Runden mit einem Hoovergerät oder Putzwagen, noch seltener sitzt ein Mann mit weißem Hemd noch vor seinem Computer. Die ganze Stadt leuchtet Abend für Abend nur, um gesehen zu werden, für die Menschen, die auf irgendwo auf einer Terrasse stehen, ihren Cocktail heben und „Wow“ sagen. Manche Firma, die sich dem Energiesparen verschrieben hat, lässt ganze Gebäude im Dunkel stehen. Das gibt einen ganz eigenen Eindruck von düsterer, melancholischer Würde. Gerade alte Steinfassaden wirken in der Dunkelheit noch mächtiger und mystischer, verlieren sich mit den oberen Stockwerken im dunklen Himmel. Wenn dort nur ein einzelnes Fenster leuchtet, erzählt uns das eine Geschichte der Einsamkeit und dem Gefühl, winzig und nichtig zu sein in dieser Stadt, die einfach nicht schlafen will.
Im Central Park glühen die charakteristischen Jugendstil-Lampen ebenfalls rund um die Uhr. In der Dämmerung erwacht hier noch einmal neues Leben, gerade im Sommer nutzen viele Sportler die Zeit nach der Arbeit, um noch zu laufen oder ein paar Runden mit dem Fahrrad zu absolvieren. Andere sitzen einfach auf den noch vom Tag warmen großen, schwarzen Felsen und trinken diverse Getränke, die manchmal verschämt in braunen Papiertüten verborgen werden. Hunde werden ausgeführt, nun von ihren Besitzern, oder toben auf den dafür vorgesehenen Wiesen herum. Ein paar Kinder turnen noch an den Spielgeräten. Wenn es dunkler wird, konzentriert sich das Geschehen auf die großen Straßen, die den Park durchziehen, und manch ein Läufer oder Sportlerin dreht nun die Runden mit einer Stirnlampe. Immer noch sind genügend Menschen hier unterwegs, um sich nicht einsam zu fühlen oder zu ängstigen.
Wenn es in den Straßen downtown dunkel wird, schillert die Reklame in allen Farben, spiegelt sich in den Regenpfützen und erleuchtet den Dampf, der aus den Gullydeckeln, Spalten im Asphalt und den rotweißen Röhren emporsteigt. Anfangs hasten die Menschen noch im Feierabendverkehr, drängen zu den U-Bahn-Stationen, deren grünweiße, ballförmigen Lampen auf die nutzbaren Eingänge hinweisen. Dazwischen strömen die Nachtschwärmer aus, reihen sich in die Schlangen vor den angesagten Restaurants und Clubs ein. In warmen Sommernächten sitzen die Gäste in überdachten Bretterhütten auf den Bürgersteigen oder dafür freigegebenen Parkplätzen. Diese Hütten unterliegen mittlerweile strengen Gestaltungsvorschriften, zu groß war der Wildwuchs, und zu groß die Gefahr, dass unter den Bretterböden sich die Ratten an heruntergefallenen Speiseresten labten. In den kurzen Zeiten von Herbst und Frühling schimmert das orangerote Licht der Heizstrahler und die Wärme wabert um die Köpfe. Vor den Türen warten die Fahrradkuriere von Gorillas, Uber-Eats und anderen Essensbringdiensten und schauen auf ihre Smartphones, um die Fahrten zu koordinieren. An einigen sehr angesagten Imbissen ist die Schlange oft so lang, dass es sich für die Fahrer nicht mehr lohnt, dorthin eine Tour anzunehmen. Zwischendrin holen auch einzelne Menschen das Abendessen für die ganze Familie ab, in den Plastiktüten stapeln sich dann drei oder vier verschiedene Behälter und warmer, leckerer Duft steigt auf. Im Kopf überschlage ich, dass das ein teures Vergnügen ist, vier Portionen à 15 – 20 Dollar plus Tax und Tip, und wenn man keine eigene Küche hat, oder aus Platzgründen im Backofen die Schuhe lagert, dann kommt über den Monat einiges zusammen. Und weil Platz in den meisten Innenstadtwohnungen immer ein Problem ist, wird hier auch nicht auf Vorrat eingekauft, sondern man lässt sich alles, was man braucht, just in time von Lieferdiensten und Fahrradkurieren bringen. Wenn ich in meinen Supermarkt gehe, gibt es dort Angestellte, die die bestellten Sachen aus den Regalen sammeln und zur Abholung im Eingangsbereich in Papiertüten bereitstellen, entweder für die Kunden selbst oder die Kuriere.
Später dringt Tanzmusik durch die Türen auf die Bürgersteige, Uber-Fahrzeuge und Taxis sammeln die ersten Gäste ein. Ich staune immer, wenn eine große Veranstaltung mit einem Publikum von mehreren Tausend Menschen in dieser Stadt zu Ende geht, wie schnell diese von wartenden SUVs mit Fahrern, Ubers und Taxis geradezu absorbiert werden, wie schnell alle in der Subway verschwunden sind. Das ist höchst effektiv und sehr beeindruckend. Nach Mitternacht wird es etwas stiller in den Straßen, aber immer noch sind genügend Menschen unterwegs. Ich nehme meine Bahn nach Harlem, am späten Abend fahren die U-Bahnzüge alle „local“, das heißt, sie halten an jeder Haltestelle. Ich laufe von der Station in der 125. Straße an der Polizeistation und einem Lokal, in dem noch eine Life-Band spielt, vorbei und biege in meine Straße. Nur noch ganz selten scheuche ich hier quiekende Ratten auf, die Politik scheint hier zu wirken. Ab und zu sieht man hier Licht aus den Souterrain Wohnungen unter den Stoops hinter Vorhängen oder Jalousien hervordrängen, selten erhascht man einen Einblick in kleine Zimmer, die bis auf den letzten Platz ausgenutzt werden, in denen ein kleiner, vertrockneter Weihnachtsbaum auf dem Küchentresen neben der Mikrowelle steht, ein Hund sich auf dem Sofa ausstreckt, oder das blaue Licht eines Fernsehers flackert. Die Schule gegenüber wird von gleißenden Baustrahlern hell erleuchtet. Im Licht der Scheinwerfer arbeiten noch drei Bauarbeiter, sie entfernen mit einer Art Pressluft-Meißel alte Fliesen von den Wänden, das macht einen Höllenlärm. Sie haben erst nachmittags, nach Schulschluss, anfangen dürfen, nun sind sie hoffentlich bald fertig, sonst wird das nichts mit einem ruhigen Abend (es ist schon fast Mitternacht). Als ich in der Wohnung angekommen bin, schaue ich noch einmal kurz zum Wohnzimmerfenster hinaus und sehe in der Ferne die Aussichtsterrasse vom „Edge“ leuchten.
Chelsea Hotel
Das Hotel Chelsea muss ich nicht vorstellen, es wurde berühmt durch die vielen Künstler, die dort vor allem in der 1960er Jahren ein Zimmer fanden, und vor allem durch den melancholischen Song von Leonard Cohen. Ich schaue mit einer unbestimmten Wehmut auf das Gebäude, das schon längst an eine Hotelkette verkauft worden und komplett renoviert worden ist.
“And I remember you well in Chelsea Hotel,
You were famous, your heart was a legend,
You told me again, you preferred handsome men,
But for me, you would make an exception.”
Leonard Cohen
Das Hotel Chelsea muss ich nicht vorstellen, es wurde berühmt durch die vielen Künstler, die dort vor allem in der 1960er Jahren ein Zimmer fanden, und vor allem durch den melancholischen Song von Leonard Cohen. Dieser Song hat mir in etlichen vergangenen Novembern in Deutschland an düsteren Tagen Trost gespendet, aber er hat auch mein inneres Bild von New York gemalt: Düster, aber nicht ohne Hoffnung, voll falscher Versprechungen und harten Abstürzen, rau und tough, dreckig, aber voller Kreativität. Hartes Schwarzweiß, mit vielen zarten und unbestimmten, verwaschenen Grautönen. Und natürlich ist New York so, aber dann auch wieder nicht, sondern vielmehr das Gegenteil: Grell leuchtend in schreienden Farben am Times Square, ein teures Pflaster, wie man so sagt, außer das fast nirgendwo gepflastert ist. Laut und schrill, atemlos hetzend, oberflächlich und ohne Tiefgang. Keine Künstler nirgends, sondern Menschen, die sich und ihre Arbeit vermarkten. Und nun komme ich von der High Line, stehe in der 23th Street zwischen der 7. und 8. Avenue vor dem Hotel, das hoch, zwölfstöckig aus roten Backsteinen gemauert vor mir aufragt. Hier lebten alle, die in den 60er Jahren relevante Kunst und Musik machten, die schwarzen Plaketten neben dem Eingangsportal machen darauf aufmerksam: Musiker-Poeten wie Bob Dylan, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Patti Smith, Leonard Cohen, Maler wie Salvador Dalí, Schriftsteller wie Arthur Miller, der Filmregisseur Rosa von Praunheim, der Fotograf Robert Mapplethorpe und, und, und. Sie haben die Zimmermiete mit ihren Werken bezahlt, es sollen heute noch Bilder von ihnen im Foyer hängen. Ich habe die zumeist schwarzweißen Fotos der verranzten kleinen Zimmer gesehen und weiß darum, dass in diesem Gebäude auch Menschen verzweifelten und an Überdosen starben. Trotzdem schaue ich mit einer unbestimmten Wehmut auf das Gebäude, das schon längst an eine Hotelkette verkauft worden und komplett renoviert worden ist. Wollte ich jetzt als Tourist nach New York kommen, wäre es mir zu teuer, für nicht etablierte Künstler unerreichbar. Ich stehe vor dem Eingang und möchte nicht hineingehen. Ich sehe ja den Glanz und Glamour auf die Straße leuchten, die Kronleuchter, Lüster, die dicken Teppiche und Wandtäfelungen. Aber ich denke an die Zeit, in der dort Künstler ein und ausgingen, durch die dunklen Korridore zu ihrem Zimmer fanden, erste zarte Akkorde zu Melodien webten, Worte dazu fanden, Gedichte vertonten, malten, fotografierten. Für mich gehört da eine gewisse Unfertigkeit der Räume dazu, in peinlich sauberen und komplett durchdesignten Räumen ist es schwer, den Anstoß zu neuen und tragenden Ideen zu finden. In meiner Vorstellung sind etliche dieser Zimmertüren gar nicht mehr abschließbar, die Schlösser kaputt und keinen kümmert es. Aus dem Nebenzimmer klingen gedämpfte Gitarrenakkorde, von der gegenüberliegenden Seite des Flurs ein Streit eines Pärchens, obendrüber übt jemand Stepptanz, und irgendwo quietschen Bettgestelle. Hier hatten sie passende Räume und den Austausch untereinander gefunden, dazu Hoteleigentümer, welche sie unterstützten, die kreativen Ausbrüche zuließen und förderten. Ich stelle mir die Atmosphäre ein wenig so vor, wie in den Zeichensälen und Werkräumen meiner Uni, wo meist junge Menschen vor sich hinbrüteten, Ideen entwickelten und Gestalt werden ließen, skizzierten, Modelle bastelten, mit Ton arbeiteten, sägten, Musik hörten. Es roch nach Klebstoff, Farbe, Zigaretten, Lösungsmitteln und Kaffee. Wenn man ein Holzbrett brauchte, musste der Nachbar schon mal auf seinen Tisch aufpassen… Am Ende, das eigentlich nie ein Ende war, sondern einfach ein erschöpftes Aufhören, weil der Abgabetermin kurz bevorstand, war eine kleine neue Welt entstanden, in den Köpfen der Schöpfer, in kleinen Modellen oder Zeichnungen, Radierungen, in Ton modelliert oder in Acryl auf große Leinwände gemalt. So könnte es gewesen sein, in diesen kleinen Zimmern, die über mir steil aufragen, durch Bänder von schwarzen, gusseiserenen Balkongeländern zusammengehalten, jedes Zimmer wie in einem Puppenhaus offenstehend, in jedem eine andere Geschichte, ein anderes Lied, eine andere Künstlerin, hier ein verrücktes Paar in zerwühlten Bettlaken, dort glimmt noch eine Zigarette im Aschenbecher, der Rauch kräuselt sich der Decke entgegen und es riecht nach frischer Ölfarbe von einer achtlos weggelegten Palette. An der Fassade hängt das große Schild mit den Leuchtbuchstaben „HOTEL CHELSEA“. Es wird demnächst versteigert werden, so kann man es zumindest lesen. Die neuen Betreiber des Hotels wollen es nicht mehr, obwohl das Hotel schon seit Jahrzehnten als Denkmal ausgewiesen ist. Buchstabe für Buchstabe soll es verkauft werden. Der Kommerz macht vor den Sentimentalitäten und vergangenen Zeiten nicht halt. Die Zimmer sind renoviert, das Parkett glänzt. Die Betten sind gemacht, das Dachgeschoß beherbergt nun keine Künstler mehr unter dem schrägen Dach, hier kann man jetzt im Spa-Bereich und dem kleinen davorliegenden Dachgarten wellnessen. In den Giebelzimmern befindet sich ein Fitnessraum, mit Laufbändern und einem Stepmaster zur Körperoptimierung, - so kann man es auf der Webseite des Hotels sehen, zwischen den Fotos aus vergangenen Zeiten, mit denen sie eine längst vertrieben Atmosphäre zu Marketingzwecken beschwören. Und wie Geister aus vergangenen Zeiten haben sich immerhin 40 Dauermieter ihr Wohnrecht erstritten, die über zehn Jahre dauernde Renovierungszeit eingerüstet und im Baulärm überstanden und leben immer noch hier, zwischen Hotelgästen, die mindestens etwa 700 Dollar die Nacht zahlen und teure Cocktails schlürfen. Nur neben dem Hotel, da gibt es einen winzigen Gitarren-Laden unter einem Schild für eine Änderungsschneiderei. Vor dem Eingang sitzt eine verblasste lebensgroße Marylin-Figur, die mir eine Ukulele entgegenstreckt. Der Besitzer des Ladens hat sie von einer Müllhalde auf Long Island gerettet. Und ich stelle mir vor wie hier Leonard Cohen, Bob Dylan oder Janis Joplin neue Saiten für ihre Gitarren kaufen, Picks oder Notenpapier für ihre Songs. Ich recherchiere, und stelle fest, dass dieser Laden so, wie er jetzt ist, erst seit 2009 in den Räumlichkeiten der ehemaligen Änderungsschneiderei existiert, aber er bewahrt die ursprüngliche Stimmung, hier hat Patti Smith eingekauft und Joan Baez war hier. Die gründlichen Renovierungsbestrebungen der neuen Hotelbesitzer wurden zumindest auf der winzigen Ladenfläche durch eine Bürgerinitiative verhindert und er bekam einen Mietvertrag für fünf Jahre. Das neu renovierte Chelsea Hotel und der alte Laden - so ist New York heute, alles ist voller Gegensätze und verändert sich ständig. Wenn ich in ein paar Jahren wieder einmal hierher zurückkehre, wird es anders sein. Aber insgeheim erfreue ich mich doch daran, dass hier noch ein kleines Stück der Vergangenheit lebendig ist.
… We are ugly, but we have the music."
aus “Chelsea Hotel“ von Leonard Cohen
Dampf und Wasser
Einige Elemente der Wasserversorgung New Yorks sind ikonisch: Wassertürme und Hydranten. Doch was hat es damit auf sich?
Immer wieder im Blickfeld: Wasserbehälter auf den Dächern der Stadt.
Einige Elemente der Wasserversorgung New Yorks sind ikonisch: Wassertürme und Hydranten. Jeder kennt die hölzernen Tanks, die auf den Dächern der älteren Gebäude der Stadt stehen. Etwa 15.000 von ihnen gibt es noch. Ich hatte ein Bild mit dem Hashtag #watertower gepostet und bekam ein freundliches Like und einen Kommentar der Firma Rosenwach. Sie sind die älteste Firma, die solche Wassertanks baut. Das Trinkwasser der Stadt kommt nur über Schwerkraft aus Reservoirs in „upstate“ New York, zum Beispiel aus den Catskill Mountains. Über die Schwerkraft kann das Wasser etwa 18 bis 22m hohe Gebäude versorgen, für alles darüber (das sind etwa 6 Stockwerke einschließlich Erdgeschoss) werden also Pumpen und eben früher Wassertanks benötigt. Die Firma Rosenwach geht ursprünglich auf einen Fassbauer zurück, und genau so wurden die Tanks konstruiert: Einfache Zedernplanken werden durch Stahlreifen zusammengehalten. Es gibt keine Dämmung, das Holz scheint trotz kalter Winter das Einfrieren des Wassers darin zu verhindern (ein großer Vorteil gegenüber Beton, der ein Überleben dieser Technik sicherte). Es gibt noch zwei weitere Firmen, die sich um den Erhalt und die Inspektion der Wassertanks kümmern, auch sie sind über hundert Jahre alt. Auf der Webseite von American Pipe & Tank kann man eine Karte von New York einsehen, auf der die Wassertürme vermerkt sind, jeder der Hunderten von Punkten steht für einen Wassertank.
Hydranten waren das Erste, was mein Bild von New York geprägt hat: Als ich klein war, brachte mir mein Onkel ein Bilderbuch aus New York mit, und darin war eine Szene gemalt, in der Kinder im heißen New Yorker Sommer durch den Wasserstrahl eines aufgedrehten Hydranten sprangen. Ein Polizist stand daneben und lächelte. Das wollte ich unbedingt auch erleben. New York wurde damit eine Sehnsuchtsstadt. Bei jedem Hydranten, auf den mein Blick fiel, musste ich an dieses Bild aus meiner Kindheit denken. Und natürlich habe ich so eine Szene kein einziges Mal erleben können. Aber: Es stimmt trotzdem. In heißen Sommern dürfen Nachbarschaften den Antrag stellen, dass die Hydranten geöffnet werden. Es gibt dafür einen speziellen Aufsatz, der den Durchflussdruck verringert und auch das Wasser ein wenig besser versprüht. Der wird dann montiert, und von 11 bis 17 Uhr können die Anwohner sich erfrischen. 1400 solcher Aufsätze gibt es für die rund 170.000 Hydranten im Stadtgebiet. Übrigens ist es strengstens untersagt, einen Hydranten privat zu öffnen, angesichts des großen Drucks dahinter würde so ungeheuer viel Wasser verschwendet. Dennoch passiert es immer wieder, dass jemand doch einen Hydranten selbst öffnet, und das wird mit heftigen Strafen geahndet.
Januar
Es schneit in New York.
Schneefall in Harlem, hinter dem Mückengitter.
Heute war es hier ein unglaublich warmer Tag mit 14 Grad. Allerdings wurde es ab Mittag dann immer kälter und heute Abend soll es frieren, ab Dienstag eventuell schneien. Ganz New York möchte endlich Schnee sehen im Central Park, und wir auch.
Und sonst so? Mit der Kälte verzieht sich Obdachlosigkeit in die U-Bahn-Stationen und auf in die einzelnen U-Bahnen. Neulich wäre mir in der U-Bahn fast ein Fentanyl-Abhängiger von seinem Sitz mir gegenüber auf die Füße gekippt. Er konnte sich kaum auf dem Sitz halten, rutsche mit tief gesenktem Kopf (den konnte er nicht mehr heben) immer wieder fast bis auf den Boden und kippte bedrohlich nach vorne. Ein Mann hustete derart im Wagen, dass alle Leute ihre Masken suchten, sich Schals und T-Shirts über das Gesicht zogen und schließlich bei der nächsten Möglichkeit den Wagen verließen. Zum ersten Mal flippte sogar ein New Yorker (sonst wird ja alles stoisch ignoriert) aus und forderte den Mann auf, nicht in den ganzen Wagen zu husten. Und in einigen Stationen riecht es jetzt - nun ja, wie das Herrenklo am Oktoberfest. Nicht schön. Aber wo sollen sie hin? Kältebusse oder so gibt es hier nicht.
Wir kommen am Abend von einer Veranstaltung. Draußen singt ein Mann ein Lied über ein schönes Mädchen, das ihn verlassen hat. In unserer U-Bahn-Station hockt ein Drogenabhängiger am Boden, völlig verkrümmt krampfend, die Polizei kümmert es nicht.
Über Nacht hat es endlich geschneit. Vor unseren Fenstern tanzen weiße Flocken. Unser Stoop (die Treppe vor unserem Brownstone House) ist von einem knappen Inch Schnee bedeckt. Ab zwei Inch Schneehöhe darf im Central Park gerodelt werden. Ich schnappe mir meine Kamera und laufe in das Schneegestöber. Einige Nachbarn räumen schon die Bürgersteige, ich muss jetzt schnell sein, wenn ich noch ein paar Bilder machen möchte. An der Markise eines Restaurants hängen dicke Eiszapfen. Auch im Central Park fahren jetzt schon kleine Räumfahrzeuge und machen die Wege schneefrei. Ich laufe um die verschneiten Ufer des Harlem Meer, hin zu den Wasserfällen in der Nähe der nördlichen Upper West Side (The Ravine), weiter am Belvedere vorbei nach Süden. Aber ach, der Schnee schmilzt schneller, als ich schauen kann. Der weiße Schnee lässt alles sauberer und freundlicher wirken, die Flocken im Wind geben eine verspielte Note, die New York sonst nicht hat. Auch wenn Schnee in einer Stadt schnell grau und schmutzig wirkt, so scheint doch für einen kleinen Moment alles verzaubert.
Ein paar Tage später schneit es wieder, dieses Mal sogar noch etwas mehr. Unser Harlem Meer ist in weiten Teilen zugefroren, die Enten watscheln durch den Schnee, der auf dem Eis liegt. Der Central Park sieht wunderschön aus. Etliche Kinder toben im Schnee auf Schlitten, obwohl sie eigentlich in der Schule sein müssten – naja, vielleicht ist das ja eine Sportstunde im Home Schooling? Der Schnee lässt die Flächen zusammenwachsen, so dass alles noch großzügiger aussieht. Aber es weht ein scharfer Wind und es ist bitterkalt. Beim Fotografieren werden meine Finger immer steifer, ich kann sie kaum noch in den Taschen meiner Daunenjacke aufwärmen, und irgendwann sind sie zu kalt, um die Handschuhe überzustreifen. Ich beschließe, Richtung Downtown zu gehen und irgendwo eine Subway zu nehmen, mich aufzuwärmen. Eine große Fläche vor der Tavern on the Green ist eine einzige große Schneematsch-Pfütze. Ich hüpfe von Eisfläche zu Eisfläche, um sie zu überqueren, sinke doch irgendwo mittendrin ein und bekomme nasse Füße. Jetzt ist es klar: Ich muss so schnell wie möglich nach Hause zurück. Ich verlasse den Park und will die angrenzende Straße überqueren. Auch hier an der Ampel stauen sich Wasser und Schneematsch in einer riesigen Pfütze – Splash! Splash! Zwei Autos fahren schnell vorbei und spritzen mich von oben bis unten nass. Ich fluche leise und sehr deutsch, nehme die nächste Subway nach Hause und dort eine heiße Dusche. Jetzt weiß ich, warum fast ganz New York heute Gummistiefel trägt.
Stadtsafari
In New York gibt es eine Menge Tiere.
Redtailed Hawk im Central Park
Auch wenn es nicht so auffällt, New York ist voller Tiere. Die 600.000 Hunde und 500.000 Katzen habe ich ja schon einmal erwähnt, aber es gibt ja auch noch Tiere, die keine Haustiere sind. Die meisten davon mag der New Yorker nicht und warnt davor. Noch bevor wir uns auf die Suche nach einer Wohnung machten, bekamen wir den Tipp, Brownstone Häuser bzw. alles „Pre War“ zu meiden. Warum? Weil sich dort oft Kakerlaken herumtreiben, die man nicht loswird. Ein beliebter Tipp von Freunden war, wenn man doch eine solche Wohnung anmietet, beim Nachhausekommen die Augen schließen, die Tür öffnen, Licht machen und dann erst die Augen öffnen. Dann seien alle Kakerlaken und das ganze Ungeziefer verschwunden.
Wir haben Glück mit unserer Wohnung – obwohl sie sich in einem Brownstone befindet, ist sie frisch und hochwertig renoviert und absolut frei von Kakerlaken.
In der Straße gibt es jedoch vor einigen Häusern flache, schwarze Plastik-Schachteln mit einem runden Loch an der Seite. Wir lernen schnell, dass das Rattenfallen sind. In den feineren Viertel gibt es sie auch in Stein-Optik. Anfangs im Herbst sahen wir abends beim Spazierengehen noch zwei kämpfende quieckende Ratten. An unserer U-Bahn Station lebte bis zu zu dem Wochenende mit den ganz heftigen Regenfällen, an dem viele Stationen unter Wasser standen, „Pizza Rat“ zwischen den Gleisen, die sich von Abfällen ernährte und auch schon mal ein ganzes Pizza-Stück ins Dunkle schleppte. Ein anderes Mal sprangen gleich drei entsetzte Ratten unter einem startendem Auto hervor. Das änderte sich sehr im Laufe des Winters. Die New Yorker Stadtverwaltung war es leid, dass New York als die „Weltstadt der Ratten“ annonciert wurde, noch vor Neu Dehli. So wurde es ernst: An der East Side wurde in jedes Rattenloch, das man fand, Gas eingeleitet. Es wurden Köder verteilt. Es wurde Gift gestreut.
An einem Abend im Januar waren wir nach einem sehr schönen Konzert (Kostenlos! Wunderbar! Wir in der 2. Reihe, direkt vor der begnadeten Sopranistin!) in einer Kirche in der Upper Westside (aber von der Carnegie Hall organisiert) auf dem Rückweg noch in einem Laden, in dem es sehr günstig französischen Käse und allerlei Leckereien gab. Als ich dann mit drei Käsestücken in der Hand zum Gemüse schritt, hoppelte dort eine gut genährt Ratte schnell über Rote Beete, Möhren, Gurken und Dill ins Dunkle… bin mir nicht sicher, ob ich dort noch einmal einkaufen werde, obwohl sie beim Käse unschlagbare Preise hatten… alles hat eben seinen Preis.
Diese Ratte ist auch der Grund, warum ich gegenüber den zahlreichen Gemüseständen in der Stadt misstrauisch bin. In Harlem bleiben einige Stände über Nacht stehen und werden nur ein wenig abgedeckt, manchmal sitzt dort noch jemand, um sie auch noch nach Mitternacht zu bewachen, aber der nickt ja auch ab und zu ein. Ich stelle mir trotzdem vor, dass die ein oder andere gesundheitsbewusste, vegane Ratte nachts sich dort wie im Paradies wähnt.
Gemüseladen-Ratte bzw.Red Beet Root Rat war jedenfalls eine der letzten, die ich gesehen habe. Es werden immer weniger, das drastische Bekämpfungsprogramm zeigt Wirkung.
Zu den beliebteren Tieren gehören die unzähligen grauen Eichhörnchen im Central Park. Im Herbst verbuddeln sie wie die Weltmeister Nüsse im Boden. Sie lassen sich füttern, sie ignorieren die Hunde. Im Frühling jagen sie einander hinterher, verteidigen entweder ihr Revier oder versuchen sich zu paaren. Manchmal hat man Glück und sieht auch ein dunkles Hörnchen. In unserem Hinterhof gab es sogar ein rotes Eichhörnchen, ganz wie zu Hause im Taunus.
Ganz wild auf die Eichhörnchen im Central Park ist ein Redtailed Hawk (Rotschwanzbussard , Buteo jamaicensis), den ich ein paar Mal im Centralpark kreisen sehe. Er soll in einem an den Central Park angrenzendem Gebäude nisten.
Auf einem anderen Spaziergang durch den Park entdeckte ich einen Waschbären hoch oben in einem Baum.
Tierisch berühmt – das war Flaco, der Eurasische Uhu (Bubo Bubo), ein Tier, dass die New Yorker in ihrer Seele berührte. Warum? Flaco war ein Zootier, er schlüpfte schon in Gefangenschaft aus dem Ei, in einem Vogelpark in North Carolina. Noch im gleichen Jahr (2010) kam er in den Zoo im Central Park. Dort lebte er über 12 Jahre, bis eines Nachts Unbekannte ein Loch in das Gitter seines Geheges schnitten, durch das er dann entkam. Niemand dachte, dass er in Freiheit überleben könnte, er war bis dahin nie frei geflogen, er hat nie selbst gejagt. Aber seine Instinkte hielten ihn am Leben und auch in Freiheit. Er verschmähte ausgelegte Köder, man konnte ihn nicht mehr einfangen. Schlaflose New Yorker sahen ihn nachts auf einem Fenstersims sitzend, er hatte einen „Stammbaum“ in der Nähe der großen Komposthalde im Nordteil des Central Parks. Ornithologen beobachteten ihn. Ich habe ihn oft gesucht, wenn ich im Central Park unterwegs war, konnte ihn aber nie entdecken. Zu dieser Zeit war er – vermutlich wegen der Störungen durch den New York Marathon Anfang November – ins East Village ausgewichen. Für die New Yorker, die sich selbst gestresst in zu kleinen Wohnungen leben sahen, gefangen in der Mühle des täglichen Überlebens, wurde Flaco der heimliche Held, ein Held, der die gestutzten Flügel ausbreitete und durch die Stadt flog, sich niederließ, wo er wollte, bei anderen durch die Fenster schaute. Wall Street Journal nannte ihn „peeping tom“, Zeynep Tufekci von The New York Times erkor ihn zum „Ultimate New Yorker“. Flaco wurde in kürzester Zeit zum Freiheitssymbol, es wurden Gedichte und Lieder über ihn verfasst. Man machte sich Sorgen, dass er an Rattengift sterben könnte, oder wie der Seeadler, der kurzzeitig über dem zentralen Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir kreiste, am Ende mit einem Auto zusammenstoßen könnte (der Seeadler hatte sich innerhalb kurzer Zeit von der Jagd auf Fische in dem Wasser Reservoir auf überfahrene Tiere am Henry Hudson Parkway umgestellt und wurde bald von einem Auto erfasst). Am 23. Februar gab es einen wunderschönen farbigen Sonnenuntergang, der alle Fassaden leuchten ließ, die rote Sonne spiegelte sich in allen Glasflächen auf geradezu magische Weise. Das schönste Abendrot, was ich in New York erlebt habe. An diesem Abend flog Flaco gegen eine Fassade in der West 89th Street und starb. Eine Autopsie ergab, dass er zu diesem Zeitpinkt bereits durch Rattengift und einen Tauben-Herpes-Virus geschwächt war.
Ganz New York trauerte, die Zeitungen berichteten, Blumen und Plüscheulen wurden unter „seinem“ Baum niedergelegt, es gab eine Gedenkfeier. Seine Übrereste wurden dem American Museum of Natural History übergeben, er wird ausgestopft werden und bleibt so Teil der New Yorker Stadtgeschichte.
Reflektionen über Reflexionen
Manche Fassaden, deren Gläser nicht eben sind, brechen die Spiegelungen wie in einem See, durch den eine Welle schwappt, so entsteht ein einzigartiges Verwirrspiel auf den Fassaden Manhattans.
Manche Fassaden, deren Gläser nicht eben sind, brechen die Spiegelungen wie in einem See, durch den eine Welle schwappt, so entsteht ein einzigartiges Verwirrspiel auf den Fassaden Manhattans.
Es fiel mir gleich bei einem meiner ersten Spaziergänge auf: Alte, steinerne Fassaden sind durchgegliedert, sie und ihre Feuertreppen, Säulen, Vorsprünge und Giebel sind plastisch, werfen Schatten. Die modernen neuen Gebäude aus Glas spiegeln, werfen gleißendes Sonnenlicht aus allen Winkeln zurück in ihre Nachbarschaft, bis auch der letzte Winkel hell erleuchtet ist.
Ich lief über die High Line, das ist – für alle, die noch nie in New York waren- ein neuer Park, der auf einer stillgelegten Hochbahntrasse auf der Westseite von Manhattan von der 14. Straße im Meatpacking District bis zur 34. Straße (jetzt Hudson Yards) mehr oder weniger parallel zur 10. Avenue verläuft.
Zu Beginn des letzten Jahrhunderts gab es im Meatpacking District über 250 Schlachtereien, nach dem 2. Weltkrieg eröffnete das Gansevoort Meat Center. 1932 war bereits die High Line eröffnet worden, eine Hochbahn, die dazu diente, die Fleischwaren in den Westen Manhattans zu verteilen. Bis 1982 ratterten hier die Gütertransporte. Eine Bürgerinitiative setzte sich für den Erhalt der Bahntrasse und die Umwandlung in einen öffentlich begehbaren Park ein. Die hohen Baukosten sollten durch vermehrte Steuereinnahmen in dem durch diese Maßnahme attraktiver werdenden Gebiet und auch die Vergabe von attraktiven Bauplätzen an Investoren erwirtschaftet werden. Tatsächlich ging der Plan weitaus besser aus, als gedacht. Das Gebiet wurde extrem attraktiv, Investoren errichteten Apartmenttürme und gläsernen Bürogebäude beidseitig der Hochbahntrasse. Und da fiel es mir, wie gesagt, auf: Hochhäuser werfen nicht nur Schatten. Die neue, fast immer vollständig verglasten Fassaden spiegeln und reflektieren das Sonnenlicht teilweise wie ein Brennglas. Stehst du im Fokus, lässt es sich im Sommer kaum aushalten. Die wenigen Schattenflächen, die sich auf der High Line (und auch sonst in der Stadt) befinden müssten, werden in der Nachbarschaft der neuen Glastürme zu wahren Brennpunkten der Gentrifizierung.
Abends gibt es allerdings interessante Zwielicht-Situationen dadurch. Für manch einen Nachbar in tieferen Geschossen ist es vielleicht die einzige Möglichkeit, über diese Spiegelungen etwas Sonnenlicht in die Wohnung zu bekommen. Aber die Qualität ist natürlich ganz anders.
Andererseits ist es manchmal ganz schön, wenn sich die Wolken oder das Abendrot auf den Fassaden spiegeln und ganze Hochhäuser so fast unsichtbar werden. Besonders interessant wird es, wenn sich andere Gebäude spiegeln und so ein einziges Verwirrspiel auf den Fotos entsteht. Manche Fassaden, deren Gläser nicht eben sind, brechen die Spiegelungen wie in einem See, durch den eine Welle schwappt.
Mich faszinieren aber die alten Gebäude mit ihren Fassaden aus Brownstone oder Gusseisen. Hier gibt es mehr zu sehen als nur das spiegelnde Glas der Fenster. Jedes Gebäude hat seine ganz eigene Struktur aus Säulen und Wandvorlagen, Mosaiken, Simsen, Gebälk, Vertikalen und Horizontalen. Im Gegensatz zu den neuen Gebäuden dominiert auch bei größerer Höhe immer noch die Horizontale. Das Maß ist eher menschlich (Ausnahmen gibt es aber natürlich auch). Im schrägen Licht am frühen Morgen und am späten Abend erwachen diese Fassaden zum Leben. Während die modernen Gebäude oft eiskalt und blau strahlen, strömen diese Gebäude Wärme und Kraft aus. Die Feuertreppen schaffen eine Verbindung in den umgebenden Raum hinein und werfen ein Netz von Gitterlinien aus Schatten auf die Fassaden. In der Pandemie wurden die Absätze der Feuerleitern genutzt, um draußen sitzen zu können. Wenn man in einem Gebäude steht und nach draußen schaut, wirkt die Feuerleiter wie ein zusätzlicher Filter, eine Erweiterung des privaten in den öffentlichen Raum, durchsichtig, aber raumgreifend. Auch die Vorsprünge von Säulen und die damit einhergehende Durchgliederung der Fassaden schafft Mini-Zonen für hier eine Sitzbank, dort zwei Blumenkübel rechts und links neben einem Eingang und vermitteln so zwischen Drinnen und Draußen. Bei den gusseisernen Gebäuden in Soho befindet sich oft noch eine geriffelte Bodenplatte aus Blech, zum Teil mit Stufen, manchmal auch eine Rampe, die auf den Bürgersteig hinausragt. Das kann eine ziemliche Stolperfalle sein, wenn man nach oben schaut, bei Regen und Schnee ist es auch manchmal ziemlich glatt. Aber auch hier wird eine Fläche des öffentlichen Raums für einen Übergang in ein Geschäft oder Restaurant genutzt.
In einer Stadt, in der überall grelle Werbung leuchtet und flimmert, wirken die Fassaden mit den klassischen Säulenordnungen nicht nur geordnet, sondern sie bringen auch Ruhe in den jeweiligen Straßenzug hinein. Hier zählt nicht die verrückteste und größenwahnsinnigste Idee, sondern die Stärke liegt im gesamten Ensemble.
Ebenso schön und kraftvoll sind die vielen Straßenzüge in Harlem mit den wunderschönen Brownstone-Häusern. Auch wenn in einer Straße zunächst einmal alle Häuser recht ähnlich sehen, so unterscheiden sie sich doch in ihren wunderschönen Details: Die Gebäude an den Avenuen sind höher, als die Wohnhäuser in den Streets. Mal verläuft der „Stoop“ (das ist die Treppe zum Eingang im ersten Stockwerk) gerade, mal geschwungen, mal über Eck. Es gibt runde Säulen neben dem Eingang oder eckige, kannelierte Wandvorlagen. Manche Häuser sind nur zwei Fenster breit, andere drei. Giebel über dem Eingang sind dreieckig oder ein Bogensegment. Wenn man eine Straße entlanggeht, merkt man plötzlich, wie ein Rhythmus in der Fassadengestaltung ablesbar wird. Natürlich kann man auch in Greenwich oder an der Upper West oder Upper East Side schöne Brownstone Häuser erleben, aber in Harlem gibt es ganze Straßenzüge davon, ganz besonders schön zwischen dem Malcolm X Boulevard (Lenox Avenue) und dem Marcus Garvey Park, rund um den Park und in den angrenzenden Straßen. Im Sommer geht man hier unter schattigen Bäumen, im Herbst und Winter, wenn die letzten bunten Blätter gefallen sind, hat man einen besonders guten Blick auf die Details. In fast jedem Block findet sich dazu noch mindestens eine Kirche, aus hellem Sandstein und im Stile eine griechischen Tempels, aus Backsteinen gemauert, aus Brownstone, mal neoromanisch, mal neugotisch. Wer Architektur aus der Zeit vor etwa hundert Jahren und mehr liebt, kommt hier auf seine Kosten.
Aussichtslos
Wer länger bleiben möchte, als ein Hotelzimmer bezahlbar und praktikabel ist, muss eine Wohnung finden. Das ist vor allem in Manhattan selbst ziemlich schwierig und vor allem sehr teuer.
Wer länger bleiben möchte, als ein Hotelzimmer bezahlbar und praktikabel ist, muss eine Wohnung finden. Das ist vor allem in Manhattan selbst ziemlich schwierig und vor allem sehr teuer.
Das wahre New York-Abenteuer beginnt weit vor der Abreise: Wer länger bleiben möchte, als ein Hotelzimmer bezahlbar und praktikabel ist, muss eine Wohnung finden. Das ist vor allem in Manhattan selbst ziemlich schwierig und vor allem sehr teuer. Für viele Menschen ist es unbezahlbar. Junge Erwachsene leben in Einzimmer-Apartments mit ihren Eltern zusammen, es gibt Lotterien für geförderte Wohnungen und die Zeitungen berichten darüber, wenn jemand tatsächlich mal über so eine Lotterie nach bis zu zwei Jahren Wartezeit endlich ein eigenes Studio beziehen kann. Wohnungsgesellschaften haben auf ihrer Webseite Foren, auf denen man nach Mitmietern suchen kann, so dass ein One Room-Apartment bezahlbar wird. Einige wenige langjährige Mieter haben noch günstige alte Mietverträge von vor vielleicht 40, 50 Jahren. Da sie für eine neuere, viel kleinere Wohnung viel, viel mehr Miete zahlen müssten, bleiben sie auch verwitwet und verwaist in üppigen Fünfzimmer-Wohnungen an der Upper West oder East Side oder in alten Firmen- oder Universitätsangestellten-Apartments wohnen. Es gibt auch mietpreisgebundene günstige Wohnungen, und manche Vermieter verschweigen neuen Mietern diese Tatsache. Keine Chance also, an rare günstige Wohnungen heranzukommen.
Vielleicht an dieser Stelle mal ein paar Begriffe:
Studio: Ein kleiner Raum, in dem alles passiert. Wenn man Pech hat, und vor allem, wenn man nicht viel zahlen kann, gibt es noch nicht einmal ein Bad, bzw. es gibt ein Klo auf dem Flur, das man sich mit mehreren Menschen teilt. Zum Duschen geht’s ins Fitnessstudio. Das kostet so um die 1200 bis 1400 $.
One Bedroom: Siehe oben, aber hier mit einem abgeteilten Schlafzimmer. So leben ganze Familien, im Wohnzimmer steht dann eine Schlafcouch. Es ist die häufigste Wohnform in Manhattan. Momentan ca. 4000 $/ Monat.
Two Bedroom: Sehr begehrt. Egal, wie die Wohnung aussieht. Es gibt zu wenige. Neue Mietverträge rufen 7.000 $ auf.
Three Bedroom: Kaum zu finden, jedenfalls nicht in Manhattan.
Egal, was man mietet, man sollte jedoch das Zweieinhalbfache der Jahresmiete (sic!) auf einem New Yorker Bankkonto vorweisen können. Jetzt rechnet doch selbst einmal, spaßeshalber.
Die Alternative ist möbliertes Wohnen für kurze Zeit. Das ist dann noch etwas teurer, aber man spart sich das Einrichten, umziehen und Maklergebühren (15 % der Jahresmiete).
Was kann man denn so erwarten für das viele Geld? Überraschend wenig. Vorsicht, wenn das Wort „Kitchenette“ auftaucht. Das ist die formvollendete Umschreibung für „Mikrowelle im Schuhregal“. „Schicke Kitchenette“ bedeutet, dass im Regal noch eine No Name –Kaffeekapselmaschine steht. Die meisten Küchen haben weder Fenster noch eine Dunstabzugshaube. Sollte es dennoch ein Fenster geben, geht es gerne mal auf einen düsteren Lichtschacht hinaus. Vorsicht auch, wenn auf den Wohnungsfotos geschlossene Gardinen zu sehen sind – das bedeutet, dass das Fenster keine Aussicht hat, in einem Schacht liegt. „Prewar“ könnte sehr schön sein, ist aber oft einfach unsäglich. Blätternde Farbe, abgelaufene Böden und Ungeziefer könnten im Preis inbegriffen sein (Das ist nicht immer so, aber oft genug). In der Innenstadt ist es sehr selten, dass einmal ein Sonnenstrahl durchs Fenster fällt. Gibt es eine Aussicht, wird dies extra vermerkt.
Weil die Wohnungsnot groß ist, finden aber auch alle diese Wohnungen in Millisekunden Mieter. Um die Lage etwas zu entspannen, und weil nach der Pandemie durch im Homeoffice arbeitende Mitarbeiter viel Büroraum nicht mehr genutzt und benötigt wird, hat die Stadt New York ein Gesetz erlassen, wonach Büroräume in Wohnungen umgewandelt werden darf. Nur sind die tiefen Großraumbüroflächen nicht so einfach umzustrukturieren. Deshalb dürfen 45% der neuen Wohnräume als „Homeoffice“ deklariert werden und tatsächlich ohne Fensterfläche sein. Der findige New Yorker legt dann sein Schlafzimmer ins Homeoffice und wohnt so direkt zum Beispiel im Financial District. Dies wiederum hat zur Folge, dass sich dort nach und nach das Stadtviertel verändert: Es gibt nun dort Supermärkte, Kneipen, die auch abends auf haben, Spielplätze und Kitas. Aber keine Aussicht aus dem Bett.
Alle die Menschen, die solche Wohnungen gefunden haben, können sich glücklich schätzen. Die Menschen am Rande der Gesellschaft leben anders. Viele der neuangekommenen Migranten aus Südamerika oder Westafrika werden zunächst in einer Unterkunft („Shelter“) untergebracht. Das können ehemalige Billig-Hotels in Midtown sein, aber auch umgewidmete Bürogebäude. Nach wenigen Wochen müssen sie diese Unterkünfte wieder verlassen, nur Familie dürfen etwas länger bleiben, aber auch nicht wirklich lange. Wer dann nicht obdachlos werden möchte, findet sich oft in sehr prekären Wohnsituationen wieder: Einige Vermieter machen ihr Geld damit, dass sie heruntergekommene Gebäude an Migranten und Tagelöhner vermieten. Während der starken September-Regenfälle verloren einige Souterrain-Bewohner ihre Behausungen durch Überschwemmungen. In Gegenden wie der Bronx und einigen Teilen Brooklyns soll es auch „Hot Beds“ geben, d.h. Menschen teilen sich schichtweise ein Bett für ihren Traum vom Aufstieg in dieser gnadenlosen Stadt.
Fehlstellen
Auch in New York gibt es tatsächlich Dinge, die ich vermisse.
Wer in New York lebt, vermisst trotzdem manchmal etwas.
Ein halbes Jahr ist eine unglaubliche Möglichkeit, besser in eine so faszinierende Stadt wie New York einzutauchen. Aber es ist zu kurz, um sich einzuleben und ein Teil dieser Stadt zu werden. Und so hänge ich zwischen den Kulturen. Eigenartigerweise habe ich mit Heimweh gerechnet und es kein einziges Mal gehabt. Aber es gibt Dinge, die ich vermisse. Eines habe ich ja schon erwähnt, aber ich kann es gar nicht oft genug sagen: Die Möglichkeit, in einem halbprivaten Raum draußen zu sitzen. Auf einer Terrasse, einem Balkon. Oder wenigstens die Hand zum Fenster rausstrecken zu können um zu schauen, ob es regnet. Oder mich raus zu beugen, zu sehen, ob der Besuch schon kommt. Die Füße auf den Fensterrahmen hochzulegen, die Sonne genießen und eine Kaffee trinken. Über den Zaun zu schauen und Nachbarn kennenzulernen. Überhaupt: Nachbarn. Spoiler: Ich lerne erst am allerletzten Tag die Nachbarn in meiner Straße kennen, aus einem wirklich erschreckendem Grund (das Kapitel dazu kommt noch). Und die gute Nachbarschaft in meiner Straße zu Hause vermisse ich auch – man achtet aufeinander, hilft sich gegenseitig und wir feiern auch gerne zusammen.
Allerdings – wer einige Zeit in New York wohnt, bekommt regelmäßig Besuch von Familie und Freunden. Zoom und Telefonate helfen zusätzlich, dass wir in Verbindung bleiben.
Ich vermisse Wald. Richtigen Wald, keine Stadtparkbäume an asphaltierten Wegen, sondern feuchte Walderde, Moos, unvermutet am frühen Morgen beim Laufen einem Reh begegnen, im Herbst Pilze sammeln und im Frühling Bärlauch. Die waldige Luft genießen, den Duft von Nadelbäumen in der Sonne. Der Central Park tut, was er kann, aber das kann er nicht. Dafür schenkt er mir eine Menge anderer toller Momente.
Selbst Musik machen. Gut, meine Posaune ist dabei, aber ich vermisse mein Orchester. Zusammen mit Gleichgesinnten einmal die Woche Musik zu machen, ist eine unglaubliche Bereicherung für mein Leben. Ich finde erst einen Monat vor Ende des Aufenthalts heraus, wo ein entsprechendes Laienorchester sich trifft, aber da ist es schon zu spät, um mitzumachen. Das ist sehr schade, ich hätte das gerne einmal ausprobiert.
Ich dachte anfangs, dass ich deutsches Brot, vor allem Vollkornbrot vermissen würde, aber da habe ich im Wortsinne vollwertigen und sehr leckeren, allerdings auch sehr teuren Ersatz in einer dänischen Bäckereikette gefunden. New York hat mich in diesem Punkt ganz besonders positiv überrascht. Jetzt ist es eher so, dass ich tatsächlich dieses Brot zu Hause ein wenig vermisse.
Was ich auch sehr vermisse, sind kleine Geschäfte mit bezahlbaren, liebevoll kuratierten Sachen, schönen Design. Da die Mieten hoch sind, sind eben auch die Preise hoch. In einigen schicken Läden, die ich im West Village sehe, traue ich mich kaum rein. Dabei ist das Verkaufspersonal immer freundlich, bestenfalls desinteressiert. Aber ab einem gewissen Preislevel fühle ich mich unwohl. Es ist einfach nicht meine Welt. Tatsächlich freue ich mich auf die kleinen Lädchen in meinem Heimatort oder auch in Marburg, in denen die Besitzer selbst stehen, mich kennen, und in denen ich oft ein schönes Schnäppchen machen kann. Da macht Bummeln einfach mehr Spaß.
Ganz selten denke ich daran wie es war, Auto zu fahren. Ob ich es vermisse? Nicht, so lange mich meine Füße in Manhattan überall hintragen, 2000 km weit in der Zeit.
Ich vermisse die Unkompliziertheit, eine Flasche Wein oder einen Begrüßungssekt einfach im Supermarkt um die Ecke einkaufen zu können. Ich hasse den demütigenden Akt, als sichtbar erwachsene Frau an der Selbstscanner-Kasse mir den Kauf einer Packung Leichtbier (wer mich kennt, weiß, ich trinke es nicht, aber wer in New York lebt, bekommt wirklich sehr viel Besuch) genehmigen lassen zu müssen: Wenn man den Artikel scannt, leuchtet eine rote, puritanische Lampe der Schande und Suchtgefahr auf, jemand vom Verkaufspersonal muss kommen, meinen Ausweis kontrollieren und dann die Kasse freigeben, damit ich mein Geburtsdatum eingeben kann. Fun fact, für euch getestet: Der Supermarkt um die Ecke akzeptiert als Geburtsdatum den 11.11.1111. Bin eben echtes Mittelalter.
Empire State of Mind
Lifegoals.
Lifegoals.
Awareness.
Fuckability.
Energy.
Core Values.
Attitude.
Purpose.
Meaningfulness.
Performance.
Sustainability.
Love.
Spirituality.
Positivity.
Investments.
Health.
Fitness.
Career.
Success.
Leadership.
Authority.
Experience.
Passion.
Development.
Adventure.
Significance.
Confidence.
Productivity.
Activity.
Happiness.
Mindset.
Growing.
Stand clear of the closing doors.
Die Tote
Nein, gemeint ist hier keine Verstorbene, sondern das New Yorker Accessoire schlechthin.
Tote bag der New Yorker Buchhandlung Strand. Quasi eine Strand-Tote.
Nein, gemeint ist hier keine Verstorbene, sondern das New Yorker Accessoire schlechthin. Oder wie Wikipedia schreibt: „Eine Tragetasche (österreichisch Sackerl, englisch tote bag) dient zum kombinierten Transport kleinerer Güter. Zum Tragen sind häufig Trageriemen oder Einlassungen vorgesehen, durch die eine Hand hindurchpasst.“
Aber die New Yorker Tote ist soviel mehr. Natürlich muss sie Einkäufe transportieren, schließlich läuft der New Yorker und die New Yorkerin ständig zu Fuß, ein Verhalten, das andere US-Amerikaner*innen so gar nicht kennen. Aber viel wichtiger ist, was die Tote sonst noch transportiert, nämlich Meinungen, Ansichten, Lifestyle:
Eine typische Tote ist eine einfache Baumwoll-Tragetasche, die qualitativ hochwertigeren aus einem etwas festeren Baumwoll-Stoff, die minderwertigen aus dünnerem. Was man hier im Supermarkt für etwa 1 -2 Euro kaufen kann, kostet in New York meistens um die 40 Dollar, denn wie gesagt, es geht ja nicht in erster Linie um den Transport von Einkäufen.
Die klassischste Tote überhaupt kann man nicht kaufen, sondern man bekommt sie, wenn man ein Abonnement beim „New Yorker“ abschießt als Dreingabe. Natürlich ziert der klassische Schriftzug „New Yorker“ die Tasche in großen Buchstaben. Es ist ein Bekenntnis zu einem intellektuellen, kulturell interessiertem Lifestyle. Wer den New Yorker abonniert hat, der liest Bücher, schätzt grafisch interessante Illustrationen, die das Leben in New York spitz kommentieren. Der New Yorker steht für einen gebildeten, akademischen Lifestyle, für die Upper West und Upper East Side, für freie intellektuelle Kapazitäten. Wenn du diese Tasche mit dir trägst, gehörst du dazu.
Aber New York wäre nicht New York, wenn es keine anderen Botschaften gäbe, die du mit einer Tote mit dir herumtragen kannst: Jede größere öffentliche Institution hat eine Tote im Angebot, so dass du dich zu ihr bekennen kannst. Ähnlich wie bei Botschaften auf T-Shirts musst du die Codes kennen, um den Wert bzw, den Status zu erfassen. Museen verkaufen Totes mit ihrem Namen darauf, das kann jeder Tourist haben. Aber es gibt natürlich spezielle Member-Editionen, zum Teil als Freebies, an denen du Gleichgesinnte im Stadtbild erkennen kannst. Universitäten, Stadtbibliothek – die Tote hat oft einen akademischen Touch, andernfalls ist sie ein Souvenir, bedruckt mit Lady Liberty, I Love New York, einem großen roten Apfel, Katzen in New York, dem LOVE-Schriftzug, dem IMAGINE-Mosaik usw.
Die Tote gibt es natürlich auch noch teurer als 40 Dollar, nämlich dann, wenn sie von Modeschöpfern in edleren Materialien gestaltet wurde, die berühmtesten Beispiele sind die verschiedenen Tote-Modelle von Marc Jacobs, in Baumwolle ab knapp 200 Euro, als kleine Lederhandtasche ab 400 Euro zu haben.
Der New Yorker nimmt die Tote also bestimmt nicht auf die leichte Schulter. Sie wird sorgfältig zum Outfit kuratiert, manchmal ist kaum etwas darin, denn es kommt ja auf die Botschaft an.
New Yorker sind verrückt nach ihren Totes, obwohl sie vergleichsweise teuer sind. Im Frühjahr hatte Trader’s Joe, eine Supermarkt-Kette im Discounter-Bereich, eine Tote für 2,99 $ im Angebot, die völlig unerwartet innerhalb von Stunden in allen Filialen ausverkauft war. Berichten zufolge wurden diese Totes oft teuer weiterverkauft, in Japan wurden sie derart gehypt, dass eine Tote sogar für knapp 3000 $ weiterverkauft wurde. Andere wurden bestickt und auf Etsy zu hohen Preisen verkauft.
In der Psychologie beschreibt das TOTE-Schema übrigens ein Modell zur Untersuchung von zielstrebigen Verhalten: Test, Operate, Test, Exit. Dessen Wurzeln werden (das habe ich mir alles auf Wikipedia angelesen) „im Reiz-Reaktionsschema der Behavioristen gesehen“. Ich finde, das passt ganz gut zu dieser Tasche, die ihren Träger in dieser anonymen Stadtlandschaft mit seiner Meinung und Haltung erkennbar macht.
Ein Hundeleben
Als einer von vielen Hunden hast du es nicht einfach in New York.
Auf der Fifth Avenue am Central Park
Als Hund hast du es nicht einfach in New York. Überall starke Gerüche: Die halbverweste Ratte unter einem Busch im Central Park oder auf einem Bürgersteig an der nördlichen 5th Avenue, der infernalische Lärm von Krankenwagen-Sirenen (110 db per App gemessen), ständig hupen Autos und Lieferwagen im ewigen Stau midtown. Sie hupen auch, wenn sie gar nicht vorwärts kommen können, es kann ja keiner ausweichen, reine Triebabfuhr. Leise sind nur die tückisch schnell rasenden E-Bikes. Mit deiner Schnauze bist du ständig auf der gleichen Höhe wie jeder Auspuff, und E-Autos gibt es hier nur relativ wenige. Fieser Dreck und im Winter Streusalz-Rückstände finden sich auf allen Wegen, das greift deine empfindlichen Pfoten an - deshalb tragen viele Hunde recht albern aussehende Pfoten-Schuhe.
Die Stadt ist grau, an den Bäume, das „Straßenbegleitgrün“, kannst du weder schnuppern noch kannst du an sie pinkeln, weil sie meistens durch kleine Metallzäune geschützt werden, welche oft gespickt mit scharfen Zacken und Dornen, damit sich auch ja kein Obdachloser darauf kurz ausruht. Es gibt nur wenige Parks in dieser steinernen Ödnis. Und auch dort sind die Flächen für den Auslauf von uns stark begrenzt. In Manhattan gibt es nur den Central Park mit größeren Flächen für Hunde. In den übrigen Parks wie Washington Square Park und Madison Park sind kleine Flächen mit Kunstrasen und einem Mini-Hügel abgetrennt und für Hunde reserviert. Im Bryant Park gibt es gar keinen Auslauf für Hunde. Wenn es also mal so einen kleinen Hunde-Spielplatz gibt, ist das natürlich nix, wenn du ein Sensibelchen bist. Irgendwie gibt es immer eine große, mächtige Töle, die den Platz kontrolliert und den anderen Schoß- und Handtaschen-Hündchen zeigt, wer hier der Boss ist. Da kannst du dich nur in eine Ecke quetschen. Dann gibt es natürlich mindestens einen absoluten Neurotiker, der nach allen schnappt. Und den unausgelasteten Hütehund, der dich einmal um den ganzen Platz jagt. Den Penner, der überall schlafen kann, auch hier, und den einzigen Schattenplatz blockiert, aber hey, die Sonne wandert ja, da musst du halt nur warten, bis der Schatten eine Ecke weiter ist. Die kleine Chihuahua traut sich natürlich nicht raus aus ihrer Chanel-Handtasche, aber immerhin schaut sie ganz aufgeregt. Für Frauchen und Herrchen ist es natürlich eine ganz andere Geschichte: Die haben hier endlich mal Sozialkontakte, stehen da mit ihren albernen Stanley Cups in der Hand, unterhalten sich und passen nicht auf, dass gerade wieder mal ein frecher Rüde am Hintern ihrer winzigen, zitternden Hündin schnuppert.
Herrchen und Frauchen sind ja sowieso Stadtwesen, sonst würden sie dich ja nicht zwingen, hier zu leben und alberne Pullis, Trikots oder Regenmäntelchen mit modischen Mustern und zu irrsinnigen Preisen zu tragen. Hallo, wir stammen vom Wolf ab, was soll das?!
Oft haben sie aber sowieso keine Zeit, dann wirst du gegen Mittag von einem Professionellen abgeholt, ein Service, der deinen Besitzer etwa 500 Dollar im Monat kostet (für eine Stunde zahlt man zwischen 16 und 25 Dollar, also lange bist du da bei diesen Preisen nicht unterwegs, das sage ich dir). Der hat einen dicken Schlüsselbund oder kennt die Zugangs-Codes von deinem Apartment und dann heißt es „Gehorchen“. Da ist Schluss mit lustig. Du läufst dann da mit mindestens einer Handvoll Kollegen über die Bürgersteige in flottem Tempo bis zum nächsten Park, dann solltest du deine Geschäfte zügig erledigen. Wenn du dich kooperativ verhältst (Stichwort: Stockholm Syndrom), lässt er oder sie dich auch mal von der Leine und frei laufen. Aber nur, wenn du in etlichen Übungen vorher bewiesen hast, dass du nicht abhauen wirst. Aber wo solltest du denn auch in dieser Sch...Stadt hin?
Für 250 Dollar nimmt dich so ein Dog Walker auch schon mal auf einen Tagesausflug raus in den Norden von New York, bis in einen richtigen Wald im Hudson Valley. Das wird dann gefilmt, damit dein Besitzer, der den ganzen Tag in einem öden, fensterlosen Office verbracht hat, sich das abends ansehen kann, während du hundemüde (haha!) in deinem zur Inneneinrichtung passenden Körbchen schläfst und träumst und nur noch ab und zu deine Pfoten zucken.
Am Wochenende kümmern sich aber unsere Besitzer selbst. Sie gehen mit uns joggen im Park (hechel), radeln (hechel, hechel, seufz, da bleibt gar keine Zeit zum Schnuppern), schleppen uns in Cafés, wo wir unterm Tisch liegen, bis uns jemand auf den Schwanz tritt. Kinder streicheln uns. Und es werden Selfies mit und Fotos von uns gemacht, denn neben Trost in dieser verrückten Stadt sind wir natürlich auch ein wichtiges Lifestyle Accessoire, ein Statussymbol.
Rechnet mal mit: 500 Dollar im Monat allein für’s tägliche Gassigehen, dazu Tierarzt, Versicherungen und vor allem natürlich Futter! Da fließen die Dollars nur so dahin – 8000 bis 10.000 Dollar sind da schnell weg im Jahr, und dann war das noch kein Luxus. Andererseits kostet ein Kind natürlich noch viel mehr, und das auch noch länger, und es braucht noch mehr Aufmerksamkeit. Und unser größter Vorteil: Ein Kind gibt dir natürlich nicht soviel Liebe zurück. Das ist ja auch unser größter Vorteil gegenüber Katzen.
Deshalb gibt es in New York auch ungefähr 600.000 von uns, aber nur 500.000 Katzen, und die sieht man fast nie draußen, die leben ja nur drinnen, zwischen Futternapf und Katzenklo, was wissen die schon von der harten Welt da draußen!
Hunde sind natürlich wichtige Arbeitgeber, nicht nur für Dog Walker, sondern auch für Tierärzte, Hundefriseure (und ja, es gibt auch Hundefriseure, die nicht nur waschen, schneiden und föhnen, sondern auch färben...), Physiotherapeuten und Tierpsychologen. Es gibt Dog Spas, in denen wir gewaschen und frisiert werden, auch im Self-Service (arrrghh, wer mag das schon, dann doch lieber Profi). Vor allem gibt es Hundetrainer, also Menschen, die unsere Menschen trainieren, damit sie wissen, wie wir so ticken. Die bekommen das ja sonst gar nicht auf die Reihe. Gerade während COVID wurden ganz viele Labradoolde-Kollegen und Maltipoos spontan angeschafft, damit die Kinder was zu knuddeln hatten und man mal raus in den Park gehen würden, aber sie machen ja doch Arbeit! Jetzt drängeln sie sich in Tierheimen und Dog Shelters und warten auf eine zweite Chance – ein trauriges Leben.
À propos Shelter - da kommt der Advent ins Spiel: Am 2. Adventssamstag konnte man tatsächlich eine Art „Hunde-Wohnwagen“ vor einem großen Tierbedarfsgeschäft am Madison Square stehen sehen. Auf dem Bürgersteig hatte eine Organisation Tische mit Formularen aufgebaut. Da konnten sich Passanten für eine Viertelstunde einen Hund zum Gassi gehen leihen und danach entscheiden, ob sie ihn gleich adoptieren (praktischerweise konnten sie dann im Geschäft dahinter alles für den Hund kaufen). Jetzt stell dir mal vor, eine Familie mit einem gelangweilten Kind kommt da vorbei und das Kind fängt an zu betteln.... nur weil du dann unvorsichtigerweise „sooooo süüüüß“ hinter deinem Gitter hervorgeschaut hast, verbringst du dann die nächsten Monate bei so einem unvernünftigen Zwerg, der dich dauernd an den Ohren und am Schwanz zieht! Und wenn du dann nach drei Monaten einmal schnappst, wirst du noch vor Ostern (und dem Skiurlaub in Colorado) wieder zurückgegeben. Adopt a Pet – also, meiner Meinung nach sollte so etwas zumindest vor Weihnachten verboten werden.... aber ist ja nur meine Meinung. Es gibt übrigens auch richtige Adopt a Pet Shops in der Stadt, neben den Tierhandlungen, in denen man auch unüberlegt und spontan mal einen Hund kaufen kann.
Es gibt natürlich einige von uns, die populärer sind, als andere, aber ein wenig hängt es auch immer davon ab, wie groß und in welcher Lage das Apartment unseres Besitzers ist: Es gibt viele Labradoodles, Maltipoos und Cockapoos, weil sie allergikerfreundlich sind und nicht viel haaren. Im Central Park kann man wesentlich mehr Corgies sehen als im Buckingham Palast. Auch Dackel (Wiener Dog) sind sehr beliebt, und zwar hauptsächlich in der Glatthaar-Variante. American Pittbulls sieht man gerne in Gegenden, in denen man sich nicht sooo gerne aufhält oder aber tatsächlich mit sehr netten, hundelieben jungen Frauen am anderen Ende der Leine. Golden Labradore und Retriever sind Hunde der Upper East und Upper West Side, große Hunde brauchen große Apartments und einen großen Park, den Central Park. Wer es geschafft hat und einen eleganten Hund benötigt, entscheidet sich für einen Weimaraner. Malteser sind vor allem bei Frauen sehr beliebt. Im Central Park an der Bethesda Terrasse läuft häufig jemand mit gleich fünf Cavalier King Charles Spaniel vorbei, aber das ist tatsächlich eine Rasse, die man nicht häufig sieht, ebenso wie vielleicht einen braunen oder schwarzen Labrador. Möpse und French Bulldogs gehören von der Beliebtheit eher ins Mittelfeld.
Eine drollige Regelung schränkt übrigens das Mitnehmen von Hunden in der U-Bahn ein: Erlaubt sind nur Hunde, die auf dem Arm bzw. in einer Tasche getragen werden können. Gut für große Hunde, dass es die großen blauen Tragetaschen eines schwedischen Möbelherstellers gibt! Manche Hundebesitzer von großen bzw. sehr schweren Hunden schneiden vier Löcher für die Hundebeine rein, dann steht da so ein Kollege in der IKEA-Tüte auf dem Bahnsteig, Fotos davon kursieren zu Hauf im Internet.
Aber auch im Rucksack werden Hunde transportiert: Einmal kam ein Radrennfahrer vorbei, der hatte einen Labradoodle im Rucksack, der ihm extrem gönnerhaft eine Pfote auf die Schulter legte und über die Schulter nach vorne schaute und den Fahrtwind genoss. Ein Bild für die Götter! So möchte wohl jeder sein Leben genießen.
Unterirdisch 2
Die Subway ist die Lebensader von New York, sie pumpt die Menschen durch diese Stadt im Takt der Züge, hin zum Herzen downtown und wieder zurück in die äußeren Stadtteile. Für einige Menschen aber ist sie ein verheißungsvoller Anfang eines neuen Lebens oder doch die Endstation.
Blick aus Subway-Linie 2 heraus auf den Bahnsteig der 96. Station.
Die Subway ist die Lebensader von New York, sie pumpt die Menschen durch diese Stadt im Takt der Züge, hin zum Herzen downtown und wieder zurück in die äußeren Stadtteile. In einer Stadt, in der Parken richtig, richtig teuer ist, hält die Subway für den Preis von 2,90 Dollar die Stadt am Laufen. Bei Starkregen überflutet, so dass die Stationen unter Wasser stehen und Fontänen zwischen den Wandfliesen hervorspritzen, so wird sie dennoch am nächsten Tag wieder fahren. Vielleicht nicht pünktlich, vielleicht ist dann nicht jede Station offen, aber die Technik ist robust genug, dass der Betrieb irgendwie weitergeht.
Über die Subway wird alles transportiert, was tragbar ist. An Weihnachten sieht man viele Menschen, die ihren Tannenbaum in der U-Bahn transportieren. Auch Sofas werden schon mal mit der U-Bahn transportiert. Essenslieferanten kürzen mit den Express-Bahnen ihre Strecken ab und blockieren mit ihren E-Bikes die Wagons. Hunde dürfen „eigentlich“ nicht mit der Subway fahren, es sei denn, der Besitzer kann sie auf dem Arm tragen. Das führt zu zum Teil zu interessanten Arrangements, es wird mit Tüten und Tragetaschen getrickst, um auch große Hunde mitnehmen zu können. Oder einfach ignoriert, dann liegt eben doch ein riesiger Schäferhund quer im Wagon.
Wenn man mit einer Express-Linie fährt, gibt es zwischen weiter auseinanderliegenden Haltestellen oft Darbietungen jedweder Art von Menschen, die sich dazu berufen fühlen, aber oft weniger berufen sind. Da wird gepredigt, es werden Gedichte vorgetragen, es spielen die Panflöten, Ukulelen, es wird getanzt und Akrobatik gemacht. Der Sound einer Boom Box füllt den ganzen Wagon und junge Männer mit freiem Oberkörper winden sich um die Haltestangen, rappen und tanzen HipHop. Die meisten Mitfahrenden schauen stoisch geradeaus, aber ein paar Leute spenden doch immer nicht nur Applaus, sondern auch einen Dollarschein.
Für einige Menschen ist die Subway ein verheißungsvoller Anfang eines neuen Lebens - zwei Dollarscheine zahlt man für Süßigkeiten, die von den kleinen, südamerikanischen Migrantinnen aus einem vor den Bauch gehängten Karton heraus verkauft werden. Diese Mädchen und jungen Frauen schleppen oft ein Baby in einem Tuch auf den Rücken, manchmal sogar Kleinkinder, die sich mit einem ebenfalls in das Tuch geschlungenen Handy beschäftigen. Im Sommer haben sie auch frisch geschnittenes Obst, hauptsächlich Mangos, im Angebot. Ihr Ruf „Mango, Mango!“ schallt durch die Stationen. Hier treffen sie sich für ein kurzes Gespräch unter Freundinnen, dann geht es in den nächsten Zug oder in den nächsten Wagon.
Und für andere Menschen ist der Untergrund die Endstation, sie ist Wohn-und Schlafzimmer für die zahlreichen Obdachlosen. Diese fahren besonders gern mit den „local“ Trains, die lange Strecken in weit außenliegende Bezirke fahren. Mehr als einmal wäre mir ein Fentanylabhängiger, der sich nicht mehr gerade halten konnte, fast auf die Füße gekippt. Man trifft hier auf das gesamte Elend, das diese große Stadt zu bieten hat, vom unversorgten psychisch Kranken über mittellose Migranten bis hin zu Drogenabhängigen, eher wenig betrunkene, aber dennoch einige Menschen, welche die Kontrolle über ihr Leben oder sogar ihre Körperfunktionen schon längst verloren haben. „The empty wagon is empty for a reason“, sagen die New Yorker, „der leere Wagen ist leer aus einem Grund“, das stimmt, immer. Und du willst den Grund nicht wissen, glaube mir.
Die Frau, die mir gegenüber in der Subway (D Linie) sitzt, beendet ihr Telefonat, stopft das Handy in ihre voluminöse Handtasche und beginnt so laut laut zu schimpfen, dass selbst der eingeschlafene FedEx-Bote neben ihr entsetzt die Augen aufreißt:
„Go to hell. Go to f***ing hell. Go to f***ing hell, you f***ing scumbag. You f***ing scumbag!!!“
Dann zieht sie ein schon etwas abgelesenes Heftchen aus der Tasche und beginnt zu lesen – der Titel: “Prayers and Contemplation”.
Unterirdisch 1
New York könnte ohne die Subway nicht funktionieren. Die Struktur der Stadt wird durch sie mitbestimmt. Und es gibt unterirdisch viel zu entdecken.
Subway Station an der 72. Straße / Central Park West
New York könnte ohne die Subway nicht funktionieren. Obwohl einzelne der 472 Stationen und vor allem die Tunnel zum Teil recht vernachlässigt und heruntergekommen wirken, wird doch seit 1904 der Betrieb aufrecht erhalten. 27 Linien erschließen den Untergrund der Stadt und verbinden für den Preis von 2,90 Dollar so weit entlegene Punkte wie Inwood 207 Street ganz im äußersten nördlichen Zipfel Manhattens bis Far Rockaway, einen Strand auf Long Island - die A-Linie. Nicht alle der momentan 370 Kilometer Strecke verlaufen unterirdisch, außerhalb Manhattans wechseln viele Linien an die Oberfläche, zum Teil auch auf Hochstrecken, wie zum Beispiel in der Bronx oder Queens. In Manhattan verläuft nur die Linie 1 für kurze Zeit oberirdisch, nämlich ab der 122. Straße, bis sie wieder aufgrund der Topographie in einen Hügel Manhattanvilles /West Harlems an der 135. Straße hineinfährt. Auch bei der Fahrt über die Williamsburg Bridge kann man in den Linien M,J und Z kurz das Tageslicht sehen.
Obwohl in Manhattan also bis auf diese Ausnahmen alles unterirdisch verläuft, wurde auch über der Erde das Stadtbild in einigen Teilen maßgeblich von der U-Bahn geprägt: Die Hauptverbindungen in Nord-Süd-Richtung verlaufen südlich des Central Parks zumindest teilweise unter den großen Avenuen: Park Avenue, 6. , 7. und 8. Avenue, aber auch unter dem Broadway entlang. Das war insofern praktisch, als dass man die Tunnel einfach von der Straßenoberfläche her ausschachten konnte. Je weiter man allerdings in den Süden die Subway entwickeln wollte, desto eher stieß man auf die alten kolonialen Straßenstrukturen. Im West Village bzw. Greenwich kann man daher sehen, dass viele Häuser, Grundstücke oder Plätze an den Straßenkreuzungen mit einer Avenue einen dreieckigen Grundriss haben. Das sind quasi die „Restflächen“ die übrigblieben, als die Avenuen in den Süden verlängert wurden. Manch ein Grundstücksbesitzer musste weichen. In einem besonders krassen Fall blieb nur ein ganz winziger Rest übrig, auf dem man heute noch eine Metallplakette sehen soll (die habe ich leider nicht gefunden).
Im Norden Manhattans wurden durch den U-Bahn-Ausbau neue Wohngebiete erschlossen. Es entstanden die wunderschönen Brownstone-Häuser in den Straßen Harlems und läuteten die große Ära der „Harlem Renaissance“ ein, der „Sugar Hill“ wurde im Swing besungen, in der „Swing Street“ und den umgebenden Clubs wurde Jazz gespielt und das Leben gefeiert.
Bill Strayhorn und Duke Ellington besangen das goldene Zeitalter, welches durch den Bau der A-Train eingeläutet wurde:
„You must take the "A" train
To go to Sugar Hill way up in Harlem
If you miss the "A" train
You'll find you missed the quickest way to Harlem
Hurry, get on, now it's coming
Listen to those rails a-thrumming
All aboard, get on the "A" train
Soon you will be on Sugar Hill in Harlem“
Die schnellen Rhythmen und die treibende Trompetenstimme geben die Modernität des Zuges, sein Pfeifen und seine Geschwindigkeit wieder, aber auch die Lust am Leben, das dort in Harlem stattfand, ungeachtet von Rassentrennung und Prohibition.
An den Adventssamstagen kann man diese Epoche in einem alten Museumszug nacherleben. Zwei Linien werden ringförmig zusammengeschlossen und jede Stunde dreht der historische Zug seine Runde. Viele Menschen fahren in Kleidung der Zwanziger und Dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts gekleidet mit. Die Wagons sind nicht klimatisiert, man schwitzt oder friert abwechselnd, die Scheiben laufen an, Ventilatoren surren über den Köpfen. Aber es herrscht gute und vorweihnachtliche Laune.
Viele Stationen wurden künstlerisch gestaltet. Die ältesten Stationen wurden im Stil von Beaux Art und Greek Revival gestaltet, die Eingänge dazu zeigen Elemente von Art Nouveau. Ab Mitte der 1920er Jahre wurde es schlichter, dafür kam „Kunst am Bau“ hinzu. In 350 der insgesamt 472 Stationen sind mittlerweile Kunstwerke zu besichtigen, natürlich alles kostenfrei bis auf das U-Bahn Ticket. Mosaiken in Harlem zeigen Szenen aus dem Jazz und schwarzer Kultur oder auch berühmte Sportler wie Jesse Owens, die 110. Station der Linien 2 und 3 ist Malcom X gewidmet. Yoko Ono entwarf die Wolkenmosaike, die zu Frieden aufrufen in der Station an der 72. Straße, gegenüber dem Dakota Building, vor dem John Lennon erschossen wurde, und von wo aus man die Strawberry Fields mit dem „Imagine“-Mosaik erreicht. Am Columbus Circle trifft man auf Mosaike des Künstlers Sol Le Witt, Roy Liechtenstein hat ein Kunstwerk für den Times Square beigesteuert, mit Lack auf Porzellan gemalt. Am Times Square kann man auch Jack Beals Mosaiken sehen, die unter anderem Straßenbauarbeiten in Manhattan zeigen. Von William Wegman sind die Weimeraner an der 23. Straße. Die Bronzefiguren von Tom Otterness an der 14. Straße finden viel Publikum, da dies eine der frequentierteren Stationen ist. Das sind nur wenige Beispiele, es gibt viel zu sehen und zu entdecken.
Noch mehr Kunst wird durch die Straßenmusiker in New Yorks Unterwelt gebracht. Das meiste davon ist ziemlich gut, denn wer hier legal spielen möchte, benötigt eine Lizenz, die es durch ein Vorspiel vor einem Komitee zu erlangen gilt. Besonders gute Musik gibt es in der Grand Central Terminal Station zu hören, da stimmen Ambiente und Akustik. Hier triff man im Winter einen meiner Lieblings-Straßenmusiker, den Trompeter Eganam Segbefia (auf Instagram unter eazy360 zu finden, bei gutem Wetter findet man ihn im Central Park) oder aber auch mal gute Cellisten. Ohne Lizenz haben zum Beispiel Greenday im Januar ein Überraschungskonzert im Rahmen der Jimmy Fallon Show in der Station vom Rockefeller Center gegeben. Natürlich habe ich es verpasst, wie so vieles in dieser Stadt. Das ist vermutlich die größte Herausforderung von New York: Überall passiert etwas Grandioses, und man kommt immer zu spät.
Die Stadt, die niemals schläft
In der Stadt, die niemals schläft, sind viele immer müde.
Eine Krise kann jeder Idiot haben. Was uns zu schaffen macht, ist der Alltag. (Anton Tschechow)
New York ist laut und geschäftig. Die Subway fährt rund um die Uhr in einem guten Takt. À propos „Takt“: Alles ist hier gut durchgetaktet. Partys oder Empfänge dauern selten länger als zwei Stunden, man hat ja schließlich danach noch etwas vor. Deshalb gibt es „Pre Theatre Menus“ und welche für danach, für alle, die nicht ins Theater oder die Oper gehen, ist der Slot dazwischen, die eigentliche Zeit, wenn zum „Dinner“ eingeladen wird. Comedy Shows fangen oft erst danach an. man trinkt sich schon vorher in Stimmung, für einige der Witze bei Stand Up Comedy ist Alkohol eindeutig von Vorteil.
Nachts wird aber nicht nur gefeiert. Die Schule gegenüber unserem Apartment wurde zum Beispiel erst nach Schulschluss ab 15 Uhr nachmittags renoviert. Da konnten dann schon mal die maroden Wandfliesen bis 11 Uhr nachts mit dem Stemmhammer abgelöst werden. Die hellen Baustrahler leuchteten auch unsere Wohnung gut aus, als bis tief in die Nacht neu gefliest wurde.
Wer nachts wach wird, hört die Müllabfuhr, die in den Nächten viel schneller durchkommt und besonders die Zeiten nach Mitternacht bis in den frühen Morgen nutzt. Ich werde vom Piepen eines rückwärts fahrenden Müllfahrzeugs geweckt. Oranges Licht füllt den Spalt zwischen den beiden Häusern gegenüber. Im Nachbarhaus geht ein Licht im obersten Stockwerk an. Ein Mann im weißen Hemd öffnet den Kragen, öffnet das Hemd. Eine Jalousie senkt sich. Es ist 2 Uhr morgens.
Das ständige Getriebensein stresst den New Yorker, auch wenn das kaum einer zugibt. Hier muss man ständig unter Strom stehen, sich gewaltig anstrengen, sonst kann man sich die schwindelerregenden Mieten für selbst Kleinstwohnungen kaum leisten. Besser, man ist Doppelverdiener. Besser, man hat nicht noch Kinder, die im besten Fall ein eigenes Zimmer haben (natürlich alle zusammen, denn three-bedroom apartments sind in Manhattan ganz selten und erst recht unerschwinglich), in die Schule gefahren werden müssen, eine Nachmittags- und eine Ferienbetreuung brauchen, eventuell ein Au Pair (das braucht dann nun wirklich noch ein Zimmer mehr). Also besser doch einen Hund? Einen Labradoodle, der nicht haart und damit in der engen Wohnung weniger Dreck macht? Oder einen Maltipoo, der auch nicht haart, aber noch weniger Platz wegnimmt? Dann wäre es allerdings besser, im Homeoffice arbeiten zu können, oder man benötigt einen Dog Walker. Alles muss organisiert werden.
Und wenn das Geld aus einem Job nicht reicht, muss ein zweiter Job her. Und neben dem Studium sowieso, es sei denn, Daddy oder Sugar Daddy bezahlen.
In dieser Stadt, in der überall Leuchtreklame in schrillen Farben flackert, andauernd Sirenen im gesundheitsgefährdenden Bereich tönen und ständig laut gehupt wird, alle immer unter Strom stehen und sogar das Mineralwasser im Supermarkt mit „Overachieving! Smart!“ angepriesen wird, sind viele immer müde. Morgens ist das ein Fall für Koffein. Dass es das in allen Formen gibt, von Americano über Cappuccino und Cold Brew, Espresso, Flat White, (Oatmilk) Latte Macchiato, Pumpkin Spiced Almond, Irgendwas Infused Coffee bis hin zu White Chocolate Mocha – das muss ich nicht erwähnen. Es fließt morgens erst in überdimensionale Pappbecher und schießt dann in Körper und Gehirn, während die Augen hinter großen Sonnenbrillen sich immer noch nicht dem Tageslicht stellen wollen oder können.
So ein Tag in Manhattan fordert. Abends ist die Subway ein großer Schlafsaal, nicht nur für die Obdachlosen, die dort regelmäßig vor allem im Winter schlafen. Leute nicken beim Warten auf die U-Bahn auf den Bänken ein, schlafen im Sitzen im Wagon und schnarchen leise.
Nicht alle können bei dieser ständigen Unruhe im Äußeren und Inneren schlafen. Der infernalische Lärm dieser Stadt und der Stress ist oft zu viel, um wirklich zur Ruhe zu kommen. So gibt es hier meterweise Regalfläche für Melantonin in den Drogerien und Supermärkten.
In der schwülen Hitze, die im September über der Stadt lag , will ich im Supermarkt etwas Wasser kaufen. An der Kasse steht vor mir eine mittelalte blonde Frau mit französischem Akzent und schiebt vier Döschen mit Melatonin-Tabletten (so ca. 50 Stück pro Dose, also insgesamt etwa 200 Tabletten) und ein einzelnes, kleines rotes Matchbox-Auto auf den Kassentresen. Mir fällt automatisch der Titel der Erzählung „Chanson Douce“ ( „Nun schlaf auch du“ ) von Leila Slimani ein. Da tötet eine Nanny aus Überforderung die beiden Kinder, auf die sie aufpassen sollte.
Später fällt mir auf, wie ruhig und schläfrig die Kinder in den großen Bollerwagen sind, welche die Nannys durch die Parks schieben. Die Kleinen hängen eingesackt und still über der Reling. Wenn sie zu Fuß gehen, rennen sie nicht, sie schleppen sich tapsend und still über den Rasen oder durch die Sandkiste. Kaum Geschrei. Es gibt übrigens auch Melantonin-Gummibärchen.
Ich sitze mal wieder in der A-Linie der Subway. Die junge Frau neben mir daddelt auf dem Handy ihres Freundes, der uns gegenüber steht und scrollt sich durch TikTok. Schließlich gibt sie ihm das Handy zurück. Ihr Kopf sinkt verdächtig, ruckt wieder hoch, fällt schließlich zur Seite. Sie rutscht zu mir, ihr Kopf liegt jetzt auf meiner Schulter. Sie schläft. Ihr Freund bekommt von alledem nichts mit. Nach drei Stationen, die sie so mit ihrem Kopf auf meiner Schulter liegend verschläft, kommt schließlich die Station, an der ich aussteigen möchte. Ich schiebe sie sanft zur Seite und stehe auf. Sie schaut etwas verwirrt, ihr Kopf sackt wieder nach vorne, sie schläft weiter.